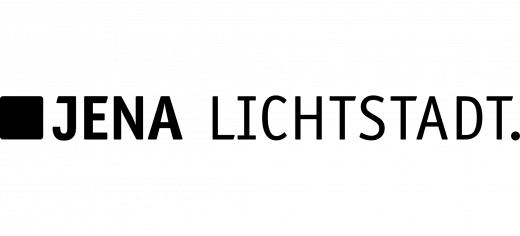Jonas Zipf im Gespräch mit Ayşe Güleç und Volkhard Knigge
Mit freundlicher Genehmigung des transcript-Verlages und der Gesprächspartner:innen veröffentlichen wir heute diese sehr inspirierende Verständigung über Gedenkkultur. Sie soll auf das bevorstehende kompakte Veranstaltungswochenende unter der Überschrift „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Komplex“ hinweisen.
Mit Jonas Zipf, Ayşe Güleç und Volkhard Knigge treffen drei verschiedene Sichtweisen aufeinander. Die zentrale Frage lautet: Wie kann eine wirksame und bleibende Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex gelingen? Welche Rolle spielen Kunst und Kultur beim Gedenken und Erinnern? Und warum nur laufen wir Gefahr, dass den Königen unserer Zeit ihre Schreiber abhandenkommen könnten?

JONAS ZIPF: Hallo Ayşe, hallo Volkhard. Ich freue mich sehr, dass Ihr beide euch bereit gefunden habt, mit mir über Gedenkkultur zu reden, gemeinsam laut nachzudenken und zu schauen, was wir an Gedanken sammeln können.
VOLKHARD KNIGGE: Guten Abend in die virtuelle Runde.
AYŞE GÜLEÇ: Guten Abend.
JONAS ZIPF: Ich habe erst gerade eben den idealen Einstieg für unser Gespräch gefunden. Vorhin, als ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, da hat er mich gefragt, wie das mit den Königen so ist. Er hat gesagt: „Wenn die Menschen mit dem König unzufrieden sind, dann verjagen sie den König.“ Und dann hat er mich gefragt, ob jeder König einen Schreiber hat. Da habe ich ihm gesagt: „Ja, das war früher so.“ Und da hat er gefragt: „Wozu hat er diesen Schreiber?“ Ich habe geantwortet: „Damit er aufschreibt, was passiert ist. Damit die späteren Generationen wissen, was früher passiert ist.“ Und dann hat er gefragt: „Gab es nur einen Schreiber?“ Ich habe geantwortet: „Ich glaube, meistens gab es nur einen.“ Und dann hat er gesagt: „Aber wenn die Leute unzufrieden sind damit, was er aufgeschrieben hat, dann haben sie ihn doch auch verjagt, oder?“ Daran anknüpfend möchte ich einsteigen mit einer Kapitelüberschrift aus dem Buch „Das Unbehagen in der Gedenkkultur“ von Aleida Assmann, die vom „Schock des 4. November“ spricht und davon, dass mit dem Öffentlichwerden des NSU ein neues Stück Öffentlichkeit in den Fokus der gedenkpolitischen Debatte gekommen ist, das in der bundesrepublikanischen Geschichte bis dahin kaum vorkam – nämlich die Menschen, die als Gastarbeiter*innen und deren Nachfahr*innen zu uns gekommen sind. Ayşe, wie geht es Dir mit diesem Titel?
AYŞE GÜLEÇ: Es kommt darauf an, für wen dieser Satz stehen soll, aus welcher Perspektive dieser Satz gesagt wird. Für viele war es ein Schock, für andere wiederum war es kein Schock. Ich erinnere nur daran, dass sich in Kassel direkt nach dem Mord an Halit Yozgat, dem neunten Opfer des NSU, die Familien zusammengetan hatten, also die Familie Yozgat mit Familie Şimşek und Familie Kubaşik. Und ich muss an dieser Stelle betonen, dass die Familien sich bis dahin gar nicht kannten – die Morde haben sie zusammengeführt. Sie haben verstanden, was eigentlich vor sich ging, haben sich zusammengetan und gemeinsam eine große Demonstration mit über 3.000 Leuten veranstaltet. Hier in Kassel zuerst, am 6. Mai, dann fand diese Demo kurze Zeit später, am 13. Juni, glaube ich, auch in Dortmund statt. Für diese Menschen war der 4. November 2011 kein Schock. Die Frage nach dem Verfassungsschutz in der Causa Kassel war ja längst ein Thema. Warum war Temme im Internet-Café in der Holländischen Straße? Warum tut die Polizei nichts? Warum schläft der Innenminister? Das waren Fragen auf dieser Demo, auf den Schildern, aber auch in den Redebeiträgen des Vaters von Halit, Ismail Yozgat. Und diese Schilder sind dann von Kassel aus nach Dortmund gewandert und sind dort noch mal gezeigt worden. Es gab also ein Wissen darüber, dass die Morde einen Zusammenhang haben, dass es Nazis sein müssen und dass staatliche Stellen involviert sind, weil sie eben wegschauen, nicht hinschauen, nicht zuhören, stattdessen die Angehörigen, die Trauernden bedrängt haben, über viele Jahre. Dieses Wissen wurde von offizieller Seite jahrelang nicht ernst genommen, nicht gehört. Das ist mein Unbehagen.
JONAS ZIPF: Dieser Untertitel spiegelt also die Sicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft?
VOLKHARD KNIGGE: Ich pflichte Ayşe bei. Wenn man vom Schock des 4. November spricht, die NSU-Morde als Urereignis nimmt, dass Menschen in Deutschland, Deutsche mit „Migrationshintergrund“ Opfer rechter Gewalt werden können, dann hat man alles, was in den Jahren vorher geschehen ist, nicht ernstgenommen. Rechte, neonazistische Radikalisierung und Gewalt haben sich lange angedeutet, schon vor 1990, sehr deutlich dann nach 1990 im vereinigten Land. Man denke nur an die Ereignisse in Rostock und Mölln. Daran, dass es Pogrome gab, Überfälle, Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte … Auch in Thüringen ist schon lange davor gewarnt worden, dass sich die rechtsradikale Szene diversifiziert, sich in Untergrüppchen, in Kameradschaften organisiert, dass sie das „Argument der Tat“ sucht und sich bewaffnet. Hätte man das ernst genommen und mit der langen Geschichte und Wirkung politisch und ethnisch ausgrenzender Weltanschauungen in Deutschland verbunden, hätte man nicht so tun können, als sei das gerade erst vom Himmel gefallen. Engagement gegen und kritische Aufklärung über diese Entwicklung gab es zwar auch immer, aber eben auch die Versuche der Verharmlosung, nicht zuletzt in Teilen der politischen Klasse. Insofern würde ich sagen – das ist ein kleiner Widerspruch zu Ayşe – da ist kein total blinder Fleck in der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch Gegenläufiges: Engagement und Aufklärungsforderungen versus Indifferenz, Verharmlosung, Vertuschung. Die von Jena ausgehende Initiative steht ja selbst in der Linie des Engagements. Diese Kräfte sollte man stärken, den – verkürzt – Geist im Sinne Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ernstnehmen. Auch dahingehend, dass dieser Artikel nicht voll eingelöst ist, immer wieder beschädigt wird. Im Licht der durch die Erfahrung des Nationalsozialismus geprägten Normativität des Artikels 1, im Licht der eingeforderten Würde und der Gleichwertigkeit des Menschen ist es unerheblich, ob du Uralt-Biodeutscher oder Nachkomme von „Gastarbeiter*innen“ der dritten Generation bist oder Flüchtling. Der Artikel gilt für alle und darauf kann man sich beziehen und Verletzungen anklagen.
AYŞE GÜLEÇ: Ich würde ja statt von Mehrheitsgesellschaft von Dominanzgesellschaft sprechen – mit dem Begriff stelle ich mich gerne zu Birgit Rommelspacher oder Max Czollek. Ähnlich geht es mir mit der thematischen Überschrift unseres Gesprächs: Gedenkkultur klingt nach staatlichem Sprechen, klingt nach Worten wie Leitkultur. Ich würde dagegen den Begriff der Erinnerungsarbeit vorschlagen.
VOLKHARD KNIGGE: Dominanzgesellschaft? Nivelliert der Begriff nicht die politische, kulturelle und soziale Diversität, die es in der Mehrheitsgesellschaft gibt und damit den Blick auf Bündnispartner*innen? Hier lohnt es sich, sich die Umbrüche deutlich zu machen, die infolge der Gewalt- und politischen Verbrechensgeschichte die Denkmals- und Gedenkkultur in Deutschland insbesondere nach 1945 verändert haben. Ganz knapp: Denkmale waren lange ausschließlich auf die angeblich positiven Figuren und Ereignisse der Nationalgeschichte bezogen. Sie zielten auf Nachfolge und Identifikation, sollten die jeweilige Herrschaft legitimieren, sie definierten Gemeinschaft und damit offen oder verdeckt auch, wer nicht dazugehört. Kurz, es ging um die Positivierung der eigenen Geschichte, nicht um die kritische Auseinandersetzung mit ihr. Es ging um die eigenen „Helden“ und die eigenen Toten und nicht um die Erinnerung anderen – politisch und staatlich gerechtfertigt – zugefügten Unrechts und Leides. Diese Form rein affirmativer Denkmalskultur ist bereits mit der Erfahrung des Massentodes im Ersten Weltkrieg aus demokratischer Perspektive in die Kritik geraten, erst recht mit der Erfahrung der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Mit dieser Erfahrung entstehen Denkmale, die nicht für sondern gegen etwas sind, die nicht Identifikation fordern, sondern die fordern, es anders zu machen, mit politischen, staatlichen, rechtlichen Strukturen bewusst zu brechen, die Gewalt, Mord und Menschheitsverbrechen legitimiert haben. Nicht: „Weiter so!“, sondern „Nie wieder!“ Walter Benjamin entwickelt in seinen geschichtsphilosophischen Thesen bereits Ende der 1930er-Jahre das Konzept des Eingedenkens: Den Opfern im Stand ihres Opferseins eingedenken heißt, ihren Tod nicht durch nachträgliche Sinngebung aus der Welt schaffen zu können, stellt den Anspruch an die Lebenden, diesen Tod wie einen Stachel im Fleisch auszuhalten, die Opfer nicht zu funktionalisieren, sich so das Leben wieder erträglich zu machen, anstatt ernstlich sich den Warum-Fragen zu stellen, zu fragen, was geändert werden muss, damit Menschen nicht von Menschen zu Opfern gemacht werden. Fassungslosigkeit bewahren, Fassungslosigkeit in Energie zur Analyse und zum Gegenhandeln verwandeln, historisch-politisch-ethisches Begreifen, Begreifenwollen anstoßen. Dafür stehen dann gerade Denkmalsformen in Bezug auf die NS-Verbrechen, wie sie ab Mitte/Ende der 1980er-Jahre entstehen. Ernstnehmen, dass Opfer und Täter nicht vom Himmel fallen. Ein Erinnern und Gedenken ohne gegenwartsbezogenes Begreifen und aus dem Begreifen handeln wollen, reicht nicht.
AYŞE GÜLEÇ: Lass uns das doch im Dialog machen. Und auf die unheimlichen Verbindungen zwischen der Geschichte und dem Heute und Morgen schauen!
VOLKHARD KNIGGE: Gerade heute können wir Gedenken nicht von Wissen trennen. Gedenken braucht Wissen darüber, wie und warum Menschen Menschen zu Opfern gemacht haben, wie es zu Gewalt gekommen ist, wie sie gerechtfertigt bzw. verharmlost worden ist, gerade auch im Fall des NSU. Das frühe Gedenken der Bundesrepublik im Blick auf den NS war ein völlig leeres Gedenken, eine historisch leere Pietät Opfern gegenüber. Dagegen wenden sich die neuen, selbstkritischen Denkmale ab Ende der 1980er-Jahre und dahinter sollte die Bundesrepublik auch im Fall des NSU, der sich ungeschminkt in die nationalsozialistische Tradition gestellt hat, nicht zurückfallen. Was die Morde hervorgebracht hat, ist noch da. Was die volle Aufklärung verhindert hat, wirkt fort.
AYŞE GÜLEÇ: Dennoch glaube ich, dass das Erinnern oder Gedenken an die NSU-Opfer noch einmal etwas anderes intendiert. Ich möchte nur einmal kurz ein Bild in die Kamera meines Laptops halten. Sie zeigt ein Foto. Das sind Mutter und Vater von Halit Yozgat mit einem Bildplakat ihres Sohnes als Kind. Ein Bild von Halit in dem Alter, als er ermordet worden ist, als 21-Jähriger. Sehr schick angezogen, mit Krawatte. Dieses Foto ist auf einer Hochzeit gemacht worden. Die Eltern haben dieses Foto immer benutzt, auch im Gerichtssaal, weil ihnen der Gerichtssaal den Raum zu sehr verengt und gewisse Erzählungen und eben ein gewisses Wissen nicht zugelassen hat. Mit dieser affirmativen Sabotage wollte die Familie Yozgat deutlich machen, dass es hier um ihr Kind geht. Es geht hier um Menschen. Die Gedenksteine für die Opfer des NSU befinden sich aber oft an Orten, die die Familien selbst nicht ausgesucht haben. Die Familie Yozgat verfolgte einen ganz anderen Wunsch nach einem Gedenkort, nämlich die Umbenennung der Holländischen Straße in Halitstraße. Diese Straße war einmal der Handelsweg zwischen Kassel und Nordholland, daher gab es argumentative Abwehr der Forderung: Es wurde gesagt, die Straße stünde für die Geschichte Kassels, die könne man nicht umbenennen. Im Umkehrschluss heißt das, dass das, was Halit passiert ist, und den anderen NSU-Opfern, nicht wichtig genug ist. Das Erinnern ist umkämpft, wenn es Überlebende und Angehörige gibt. Deshalb ist es auch wichtig, über all diese Ambivalenzen und Schwierigkeiten zu sprechen. Auch darüber zu sprechen, dass es einen Widerspruch zwischen Wünschen nach staatlicher Gedenkpolitik oder Gedenkkultur und dem, wie die Familien selbst gedenken wollen, gibt. Vor diesem Hintergrund würde ich auch gerne die Reihenfolge der Begriffe des Titels des Buches umdrehen, für das wir hier zusammen sind. Statt „Rassismus. Macht. Vergessen“ würde ich umgekehrt anfangen: „Vergessen. Macht. Rassismus“.
JONAS ZIPF: Diese Umkehr bezeichnet präzise den Unterschied der beiden gedanklichen Stränge, die ihr jetzt beschrieben habt. Volkhards kurze Geschichte der Gedenkkultur verdeutlicht, dass sich die Repräsentationsdynamik praktisch innerhalb von weniger als 150 Jahren von Reiterstandbildern bis zu den identitätspolitischen Diskussionen von heute entwickelt hat. Dazwischen liegen die wahnwitzigen kollektiven Traumata zweier Weltkriege mit all ihren anonymisierten Opfern.
Daraus ergibt sich die Frage nach der Funktion von Gedenkkultur, einerseits nach dem, was wir lernen aus dem, was in der Vergangenheit war, und andererseits nach dem, wie wir Gesellschaft und Gemeinschaft in Zukunft gestalten. Hier lohnt sich demzufolge vielleicht auch der Begriff der Gedenkkultur, denn es ginge tatsächlich um etwas Gemeinschaftliches: um das Potenzial, dass eine Gesellschaft etwas über sich selbst lernt und dieses Wissen transferiert. Dagegen der Strang, den Ayşe aufmacht, der nach der Authentizität von subjektiver Erinnerung fragt: Um wen geht es konkret? Welche Bilder haben wir von den Opfern im Kopf? Das menschlichere Antlitz, das freundlichere Antlitz, das lachende Porträt-Bild, ganz im Gegensatz zu den bekannten Bildern der NSU-Opfern, die eher Fahndungsfotos ähneln. Dieser Strang fragt nicht nach der kollektiven Funktion von Gedenken, sondern danach, ob wir der Erinnerung an die Opfer gerecht werden.
Ich frage mich: Stehen diese zwei Diskurse einander wirklich so diametral gegenüber, wie es scheint? Ein Schlüssel zur Verbindung beider Sichtweisen könnte das Paradox sein, das Walter Benjamin uns auf den Weg gibt mit dem Hinweis auf das Ein-Gedenken, das Inne-Halten, ich möchte es mal mit dem Begriff der Logischen Sekunde fassen.
AYŞE GÜLEÇ: So einfach ist das nicht. Was ich mit dem Hinweis auf die Diskussion rund um die Halitstraße deutlich machen wollte: Es genügt nicht, eine Stele in den Boden zu rammen und eine Platte mit den Namen der Opfer zu haben. Das ist aber das, was in Kassel gemacht wurde, genauso wie an anderen Orten. Das sind zwar wenigstens Orte, an denen wir uns an den Jahrestagen versammeln können. Aber es zeigt sich, dass die Stelen und Platten nicht reichen: Denn diese Gedenkorte sind Seismografen dafür, wer sich erinnern möchte und wer den Luxus hat, sich nicht erinnern zu müssen. Der Grund, warum es so wichtig ist, auf die Kämpfe um Erinnerung der Überlebenden zu bestehen, ist, dass sie im offiziellen Erinnern eben nicht gehört werden. Mir geht es nicht um Identität und auch nicht um identitäre Kategorien. Aber bei den Morden des NSU ging es ja offensichtlich um identitäre Zuschreibungen. Das zu verstehen bedeutet, dass wir über eine andere und zwar nicht identitäre Erinnerungs- und Gedenkpolitik nachdenken müssen.
VOLKHARD KNIGGE: Auch das ist etwas, was gedenkkonstitutiv ist. Ich betrachte deine treffende Beobachtung als Hinweis auf ein Spannungsverhältnis, nicht auf einen Widerspruch. Es ging und geht beim historischen Erinnern und Gedenken sowohl um die Erfahrung und Perspektive der unmittelbar Betroffenen als auch um die faktisch und methodisch so sorgfältig wie möglich ermittelten umfassenden Sachverhalte und Kontexte der Taten. Andernfalls kann man Behauptungen und Wahrheit – Wahrheit wenn nicht absolut so doch als Anzustrebendes – nicht unterscheiden. Worauf ich hinaus will: Persönliche Erfahrungen und Einschätzungen und umfassende Sachverhaltserschließung können in einem Spannungsverhältnis stehen. Darum geht es mir und darum, damit im Fall menschlich angemessen und doch sachlich klar und nachvollziehbar umzugehen, damit ein Denkmal und seine Aussage möglichst breit überzeugen und Angriffen standhalten.
Damit kein Missverständnis entsteht. Angehörige haben mit ihrer unmittelbaren Erfahrung des gewaltsam herbeigeführten Verlustes geliebter Menschen, wegen ihrer Nähe zu den Gemordeten und weil auch sie verwundet worden sind, unbestreitbar das Recht anzuklagen, die Gesellschaft herauszufordern: Schaut hin, was mein Schmerz ist. Seht das Unrecht! Nehmt es ernst! Tut was! In dem „Schaut hin“ steckt aber schon die Verbindung zu den anderen Menschen, zur Gesellschaft. Es geht im Gedenken an die Opfer politischer Verbrechen letztlich darum, sich, so gut es geht, in die Gewalt- und Leiderfahrungen der anderen nicht nur hineinzufühlen, sondern auch hineinzudenken, um zu begreifen, was eigentlich passiert ist und warum es dazu kam. Dafür braucht es die konkreten Bilder der Ermordeten; dafür braucht es die Konfrontation mit den Wunden, die geschlagen worden sind. Aber es braucht auch die nicht unmittelbar Betroffenen, die sagen, das geht mich an: mitmenschlich und weil gemeinsame Werte und Grundrechte verletzt worden sind. Die sich fragen: Was bedeutet die Erfahrung dieser Gewalt auch für mich, für den Zustand der Gesellschaft, ihrer Institutionen? Was muss anders werden? Das sind Fragen, die alle angehen. Kurz: Öffentliche Denkmale gegen politische, rechtsradikale, rassistische Gewalt müssen die Erfahrung der Opfer sehr ernstnehmen und gleichzeitig über jeweilige Einzelperspektiven hinaus ein politisches Zeichen setzen, das in einem der demokratischen Kultur angemessenen Verfahren entwickelt wird.
Was Jonas uns gerade gespiegelt hat, trifft allerdings zu: Auch die ästhetischen Formen und die Sachdimension, der Denkmalsgedanke, können differieren, auch sie stehen in einem Spannungsverhältnis. Damit ein Denkmal zum aufrüttelnden Denkmal werden kann, es Menschen breit in der Gesellschaft – wortwörtlich – bewegt, muss die Gesellschaft an der Diskussion beteiligt werden.
AYŞE GÜLEÇ: Dennoch bleibt die Frage im Raum, wer es sich leisten kann, sich nicht zu erinnern. Im Kontext des NSU gibt es Menschen, die müssen sich erinnern. Ich möchte keine Separierung oder Spaltung der Gemeinschaft, aber sie ist faktisch da: Es gab und gibt einen Teil der Bevölkerung, der wusste, was passiert, und einen Teil, der wegschaut. Das Morden des NSU, die Taten des NSU passierten am helllichten Tag, vor unseren Augen. Und trotzdem haben wir es nicht gesehen.
JONAS ZIPF: Ich möchte Euch eine andere Frage stellen. Ich drehe das Verhältnis derer, die sich erinnern müssen und derer, die es nicht müssen, jetzt mal um und sage: Ob sie wollen oder nicht, es gibt eine ganze Reihe von Amtsträger*innen, die sich erinnern müssen, sich bei der Wahl der Mittel aber mitunter hilflos benehmen. Ich mache ein Beispiel. Der hessische Landtag hat vor einigen Wochen im Angedenken an die Opfer und Angehörigen des Anschlags in Hanau Musik aus dem klassisch-romantischen Repertoire für den zentralen Gedenkakt des hessischen Landtags ausgewählt. Nun kann man sich darüber streiten, ob Beethoven & Co vielleicht eher den gedenkkulturellen Kontext und Erwartungshorizont der Landtagsangehörigen treffen. Aber mit der interkulturellen Perspektive, der sozialen Zugehörigkeit oder gar den persönlichen Vorlieben der Angehörigen hat diese Musikauswahl sicher weniger zu tun. Dagegen will ich euch fragen: Was sind gelingende Beispiele, die es vermögen, mit den Mitteln von Kunst und Kultur andere Teile der Gesellschaft zu erreichen?
VOLKARD KNIGGE: Ich kann nicht allein über ästhetische Formen sprechen und traue ihnen diese Qualität auch nicht umfassend zu. „Erinnerungskunst“ und Denkmale werden oft überfrachtet und überfordert. Aufklärerische, (selbst-)kritische Erinnerungskultur ist im gesellschaftlichen Konflikt entstanden. Das hat nicht die Kunst gemacht. Die Kunst konnte Teil des Konflikts sein. Man denke an die Diskussionen um Auschwitz und den Holocaust, bis hin zum Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden. Vor den Denkmalen waren immer wieder politisch-gesellschaftliche Kämpfe gegen das Verdrängen. Natürlich können Opfer von Gewalt und ihre Angehörigen, das habe ich in 30 Jahren Arbeit mit Überlebenden immer wieder erlebt, nicht vergessen. Trauma und Schmerz bleiben virulent. Auch Täter*innen können nicht wirklich vergessen, sie tun nur so. Hier geht es nicht nur um Erinnern und Vergessen, sondern es geht auch um Erinnern und Lügen. Lügen haben mit Vergessen nichts zu tun. Auch deshalb muss Gedenken personenkonkret sein, opfer- und täterkonkret: Wer sind die Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind? Welchen Schmerz haben sie erlitten? Aber auch: Wer hat das getan, aus welchen Gründen? Wer oder was hat beigetragen? Wer hat laut oder leise geklatscht? Wer hat es mit angesehen? Wie ist das gerechtfertigt worden? Es geht auch um Ereigniskonkretion: die genauen Tatorte, Tatabläufe, Tatwirkungen, Kontexte. Und es geht um Auseinandersetzung und Aufklärung: Wer konnte davon wissen? Wer hat etwas verdeckt? Aufklärung betrieben oder Aufklärung behindert, gerade auch in Institutionen, die eigentlich der Verbrechensaufklärung verpflichtet sind bzw. sein sollten.
AYŞE GÜLEÇ: Das möchte ich unterstreichen. Und übertragen auf den NSU: Die Ortskonkretion ist für die NSU-Opfer von großem Interesse. Fast alle Gedenkorte, die es für NSU gibt, liegen nicht in der Nähe der Tatorte. Man wollte sie immer weit weg haben. Fast alle Gedenksteine beginnen nicht mit den Lebensdaten der Personen, sondern mit dem Datum ihres Todes. Ich frage mich dabei: Wie kann ein Gedenkort aussehen, der das Leben und nicht das Sterben der Person thematisiert? In Kassel hat sich die Stadt letztlich entschieden, nicht die Holländische Straße, sondern den Haupteingang zum Zentralfriedhof Halitplatz zu nennen. Dort steht jetzt eine Gedenkstele. Dieser Platz war vorher kein Platz, zumindest nicht im architektonischen oder soziologischen Sinne, sondern der Haupteingang zum Friedhof. Die Bepflasterung wurde so verändert, dass der Ort aussieht wie ein Platz, aber er ist kein Platz. Was würde es dagegen bedeuten, wenn die Holländische Straße Halit-Straße hieße? Dann müssten alle, die dort wohnen, mit dem Namen von Halit leben. Und das ist doch etwas ganz anderes als die Nähe der Toten zu den Toten.
JONAS ZIPF: Das geht in die Richtung meiner Frage von vorhin. Ich spitze sie noch mal zu: Sind Musikstücke von der „Antilopen Gang“ oder von „Feine Sahne Fischfilet“ möglicherweise besser dazu geeignet, das Erinnern und Gedenken an Opfer und Angehörige des NSU in eine viel breitere Bahn zu lenken, weil Jugendliche diese Musik hören, die Namen hören – #saytheirnames – und dadurch an die Opfer denken, als jeder gedenkpolitische Diskurs über Kunstwerke im öffentlichen Raum? Ich will dabei einfach nur nach dem schnöden Momentum der Aufmerksamkeit fragen: Sollte das nicht eigentlich der oberste Anspruch sein? Sind es nicht Filme wie „Schindlers Liste“, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht vergisst? Letztlich beschreibt das den Anspruch, aus dem die im 20. Jahrhundert gewandelte Gedenkkultur im öffentlichen Raum herrührt. Hilmar Hoffmanns Leitspruch „Kultur für Alle“ zielt auf eine Kunst im öffentlichen Raum, die immer anschlussfähig für eine breite Masse von Menschen sein soll. Diesen kulturpolitischen Anspruch hast du mit dem Beispiel des Straßennamens ganz plastisch beschrieben und gut getroffen, Ayşe. Das ist etwas, an dem niemand vorbeikommt. Ich gehe jeden Tag durch diese Straße, ich lebe dort, ich kann mir nicht aussuchen, ob sie Holländische Straße oder Halitstraße heißt. Vielleicht messe ich dem Stein, der da rumsteht, keine Bedeutung mehr bei, weil er immer da steht, diesem Brunnen oder diesem Denkmal. Aber der Impetus dieser Anfassbarkeit war und ist eine höchst demokratisierte Form für Kunst.
VOLKHARD KNIGGE: Ich muss einen kleinen Einspruch erheben, Jonas. Man sollte zwei Dinge nicht gegeneinandersetzen. Breitenwirkung ist zunächst nicht meine erste Frage. Breitenwirkung ist bereits eine Aufgabe und Herausforderung für die Gestaltung des Prozesses, der zu einem Denkmal führen soll und Breitenwirkung gehört in den Bereich der Vermittlung. Vermittlung in die Breite hat als Voraussetzung, dass etwas von der Relevanz des zu Vermittelnden zumindest in einem Teil der normsetzenden Schichten einer Gesellschaft angekommen ist. Und genau das macht den Gedenkakt im Hessischen Landtag, bei aller Kritik im Einzelnen, auch aus. Da mag Musik gespielt worden sein, die Ignoranz gegenüber den Herkunftswelten der Menschen, um die getrauert werden soll, zum Ausdruck bringt. Das muss man kritisieren. Aber solche Gedenkakte sind auch Akte der Normsetzung bzw. -bekräftigung. Sie markieren, was Recht und was Unrecht ist, sie sind auf die ganze Gesellschaft bezogene Akte moralischer, rechtlicher und politischer Selbstversicherung und Selbstverpflichtung. Solche Akte braucht es. Sie haben eine Tendenz zur Ritualisierung, manchen mögen sie nur Lippenbekenntnis sein. Zugespitzt: Wir kennen die Reden, wir kennen die Gesten, wir kennen die Musikstücke, wir kennen die Grünpflanzen, mit denen die Mikrofone umstellt werden. Trotzdem steckt darin etwas elementar Wichtiges im Sinne dieses normbekräftigenden, normstärkenden und auch normverteidigenden Aktes. Und dann ist da die Aufgabe der Vermittlung. Dafür braucht man einen langen Atem. Aber wenn sich etwas ändert, dann geht das vorher über Konflikte und wer sich in diesen Konflikten durchsetzt. Da ist etwa in Bezug auf Auschwitz ein Generalstaatsanwalt wie Fritz Bauer Anfang der 1960er-Jahre in Hessen, der gegen größte Widerstände die Frankfurter Auschwitzprozesse anstrebt, wohl einschneidender als Musik oder Filme. Auch wenn beides ineinander spielt, auch wenn z.B. ein Film wie „Nacht und Nebel“ von Alain Resnais lange vor 68 einen großen Teil der jüngeren Westdeutschen sensibilisiert und mobilisiert. Im Endeffekt kenne ich aber auch nach 30 Jahren kein Patentrezept. Es gilt einfach, verschiedene Formate auszuprobieren, auch in Kombination: »Feine Sahne Fischfilet«, ich sage es einmal zugespitzt, erreicht eine Welt. Und Beethoven erreicht eine andere Welt.
AYŞE GÜLEÇ: Das mit dem normsetzenden Akt leuchtet mir ein. Aber Du kannst die Frage nicht negieren, wer diese Norm auf welche Art und Weise setzt. Sie wird für andere gesetzt und nicht mit anderen. Und das ist, glaube ich, das Problem.
VOLKHARD KNIGGE: Dass man Menschen nicht umbringt, dass Rassismus Verbrechen nicht legitimiert, sondern hervorbringt, selbst eins ist, sollte eine Norm sein, die jede und jeder bekräftigt. Bei aller Berücksichtigung des Besonderen bin ich ein Universalist. Hier geht es weniger um die Form des Denkens als um den Inhalt dessen, was wir daraus zu schließen haben. Wenn gegen zivilisatorische Grundnormen, wenn gegen Artikel 1 Grundgesetz zum Schaden von wem auch immer verstoßen wird, jemand – egal wer – sogar zu Tode gebracht wird, dann trifft mich das. Und es hat mich zu treffen. Mich und jeden anderen, der diese Verfassung ernst nimmt. Das meine ich mit normsetzendem Akt. Andererseits und ja, dass manche Politiker überhaupt normsetzend bzw. -bekräftigend agieren, verdankt sich leider nicht selten erst gesellschaftlichem Druck.
AYŞE GÜLEÇ: Aber es trifft viele nicht. Ganz und gar nicht. Das ist doch das Problem, das wir haben. Es trifft viele nicht. Viele trauern nicht. Das klingt erst einmal toll, wenn zum ersten Gedenktag an Hanau in Berlin 3.000 Leute auf die Straße gehen und Aktionen machen, überall Menschen an Demonstrationen oder Gedenkfeiern teilnehmen. Aber entschuldige bitte: Es ist nicht die Mehrheit!
VOLKHARD KNIGGE: Darum kämpfe auch ich. Und damit lebe ich mein ganzes Leben, Ayşe.
AYŞE GÜLEÇ: Ich auch. Da können wir uns die Hand reichen.
JONAS ZIPF: Ich habe ein anderes Problem: Den Unterschied zwischen dem normsetzenden Akt und der Vermittlung, den du machst, Volkhard. Auch ich bin Universalist und sage: Es geht immer und überall um die unverhandelbaren, unveräußerlichen Menschenrechte. Gleichzeitig verstehe ich Ayşe. Da müssten wir demokratietheoretisch ansetzen, Governancekonzepte kritisieren und laut fragen: Wer repräsentiert wen? Aber wenn es jetzt darum geht, über Kunstwerke zu sprechen, dann greift die Reduzierung auf den Aspekt der Vermittlung zu kurz. Immerhin sprechen wir über Gedenk-Kultur, also etwas, was in Gesellschaft, in Gemeinschaft entsteht und was andere erreichen, möglichst viele mitnehmen soll. Wenn das funktionieren soll, empfinde ich die Unterscheidung zwischen dem, was top down definiert, und dem, was erst anschließend vermittelt werden soll, als ausgrenzend. Genau an dieser Stelle hat sich der
Kunstbegriff doch stark gewandelt.
Nehmen wir nur mal das Format des dezentralen Denkmals. Das ist ein durch und durch demokratisches Kunstwerk, bei dem die normsetzende Kraft, nicht mehr allein beim Künstler liegt – der bekannteste Fall dürften die Stolpersteine von Gunter Demnig sein –, sondern die Realisierung der künstlerischen Idee, und damit des Gedenkens, in die Hände vieler gelegt wird. Mir fallen viele Beispiele ein, die noch weit darüber hinaus gehen. Beispiele für Kunstwerke im öffentlichen Raum, für Gedenken, das tatsächlich nicht erst bei der Vermittlung, sondern mit der Partizipation und der Beteiligung anderer Bevölkerungsschichten am Schaffensprozess beginnt, bei denen die Beteiligung von vorn herein dem Kunstwerk und damit dem Gedenken selbst eingeschrieben sind. Ich denke da an die unzähligen Formate der sogenannten Bürgerbühnen; an diverse Interventionen im öffentlichen Raum, die sich hart an der Schnittstelle zwischen Kunst und Aktivismus entlang bewegen, etwa die Arbeiten von Thomas Hirschhorn oder Christoph Büchel bei den letzten Ausgaben der Wiesbaden Biennale; oder an etliche Arbeiten bildender und darstellender Künstler von Schlingensief bis Signa; sowie, latest but not least, im Kontext unseres bundesweiten Projekts „Kein Schlussstrich!“ das Musikprojekt des Komponisten Marc Sinan, der gemeinsam mit diversen Laien-Ensembles unter Beteiligung der Theater im öffentlichen Raum aller vom NSU-Komplex betroffenen Städte einen „Neuen Humanismus“ einfordert.
Das ist das, was mich interessiert: ein neues Kapitel der Gedenkkultur, ein demokratischer Übergang, jetzt auch kommunalpolitisch gesprochen, von Entscheidungsfindungswegen. Denn ein zunehmender Teil der Bevölkerung ist unzufrieden mit den bisherigen Wegen und beansprucht, direkt mitzubestimmen. Nicht umsonst hat sich genau vor diesem Hintergrund ein Arbeitskreis der Kommunen gegründet, initiiert durch die Stadtverwaltung Halle, weil die Hallenser*innen gemerkt haben, nach dem Attentat auf die Synagoge vor über einem Jahr, dass sie nicht alleine im Kreis der Expert*innen, Stadträt*innen und Politiker*innen entscheiden können, wie Gedenken in dieser Stadt entsteht. Die gedenkpolitisch verantwortlichen Menschen unterschiedlicher Kommunen sitzen da zusammen und tauschen ihre Erfahrungen mit Beteiligung der Zivilgesellschaft aus. Alle merken, dass wir uns in einem sehr fluiden Übergangsstadium befinden. Das meine ich gesellschaftspolitisch, aufgrund der Einflüsse von Aktivist*innen, aber auch künstlerisch. Wir erleben einen regelrechten Generationswechsel. Die Art und Weise, wie bisher Gedenkkultur entstanden ist – wie Künstler*innen dazu eingeladen wurden, sich alleine, im stillen Kämmerlein, Gedanken zu machen und diese bei einem Wettbewerb einzureichen – dieser Autorenbegriff im klassischen Sinne, eine stellvertretende, repräsentative Perspektive einnehmen zu können, kommt an ein Ende. An diesem Punkt der Veränderung gehe ich die Unterscheidung zwischen dem Kernpunkt des Normsetzens und einer ihm nachgeordneten Vermittlung nicht mit. Warum Inhalt und Form so stark voneinander scheiden, wenn die Formate, denen der Anspruch der breiten Vermittlung von Anfang an eingeschrieben ist, so viel wirksamer sein können?
AYŞE GÜLEÇ: Ich finde auch, dass sich da momentan etwas verändert. Es geht anders. Ich war zweimal in Hanau und ich war sehr beeindruckt davon, wie sich dort intuitives Gedenken ereignet hat. Nach den Morden sind die Bürger*innen zum Marktplatz gegangen. An der Gebrüder-Grimm-Statue werden Blumen abgelegt. Dort wird getrauert um die Mordopfer. Dort werden Kerzen niedergelegt. Die Marktfrau, die Blumen verkauft, wechselt, wenn sie da ist, das Wasser, damit die Blumen länger dort sind. Der Platz ist noch immer voll mit Blumen und mit Kerzen.
VOLKHARD KNIGGE: Ich predige keine Top-Down-Verordnung einer Memorialästhetik. Es geht um die Bekräftigung, auf welche Normen sich eine Gesellschaft verständigt. Was ist Recht und was ist Unrecht? Was ist Gerechtigkeit und was ist Ungerechtigkeit? Darum geht es. Denn wenn diese Normen nicht bekräftigt werden, auch von der politischen Klasse nicht bekräftigt werden, und man die politische Klasse nicht auch von unten herausfordert, diese zu bekräftigen und sich der Verteidigung dieser Normen zu stellen, dann wüsste ich nicht, wie man etwa solche Denkmalskonzepte gesellschaftlich tragen könnte. Die von Dir beschriebene Partizipation und Interaktion, Jonas, erreicht doch nicht als solche und automatisch die Massen. Sie korrespondiert mit dem Zerfall des Denkmalbegriffs, mit der Krise der Repräsentation, das stimmt. Das haben wir schon in den 70er, 80er Jahren erlebt. Da wird das Problem schon gesehen: Wer setzt für wen welche Denkmäler? Wer hat die Definitionsmacht? Und kann es in einer pluralen, heterogenen, diversen Gesellschaft mit vielen Perspektiven überhaupt noch so etwas wie das eine Denkmal für alle geben? Aber gibt es nicht zivilisatorische Grundnormen, Rechte, auf die wir alle angewiesen sind? Sind Menschwürde, Menschen- und Bürgerrechte nicht communityübergreifend? Auf der einen Seite braucht es die berechtigterweise geforderte Vielheit, aber auf der anderen Seite sollten wir uns bei aller Vielheit und vor jedem Anspruch an Breite in Bezug auf das einig sein, was politisch, rechtlich, kulturell oder sozial in keinem Fall der Fall sein darf, damit Staat und Gesellschaft ihren humanen, ihren solidarischen Atem nicht verlieren, damit Staat und Gesellschaften nicht ins Menschenfeindliche kippen, dafür braucht es genau an diesem Punkt einen Grundkonsens.
AYŞE GÜLEÇ: Aus wem besteht denn die Gesellschaft? Wer ist das genau? Wie wird denn mit denen gesprochen, die sich nicht als Teil dieser Gesellschaft fühlen, die sich aber sehr wohl von den Anschlägen adressiert sehen? Wie begegnen wir dieser Exklusion?
VOLKHARD KNIGGE: Die Gesellschaft sind die verschiedenen Menschen, die hier zusammenleben und wie auch immer sozial miteinander interagieren. Für deren Zusammenleben gibt es einige grundlegende Rechte bzw. universalistische Normen, die in der Verfassung bekräftigt und verbürgt sind, auf die gestützt man auch Uneingelöstes und Unrecht beschreiben kann. Dass Norm und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dass es Machtgefälle gibt, dass Menschen- und Bürger*innenrechte politisch ausgehöhlt und auch offen bekämpft werden können und werden, ist mir klar. Trotzdem sollten wir dahinter nicht zurückfallen, diese Rechte verteidigen. Andererseits, ja es stimmt: In der Frage, was das richtige, was das gute Leben ist und seine Voraussetzungen, da gibt es wahrscheinlich viele unterschiedliche Auffassungen, Diskussionen, auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen mit und in diesem Land, der Gesellschaft, der politischen Ordnung. Deshalb sollten Gedenkprojekte auch als Foren der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven verstanden werden. Trotzdem ist mir wichtig, dass wir sachlich feste, nachvollziehbare, analytisch gewonnene Begründungen finden müssen. Wir sprechen über ein Verbrechen. Und Mord ist überall ein Verbrechen – auch und gerade in der Bundesrepublik mit ihrer rechtlichen Verfassung. Gleiches gilt für Diskriminierung und die Verletzung der Menschenwürde. Und schon deswegen geht es jeden an. Und damit meine ich uns als Menschen und als Staatsbürger*innen. Es ist prinzipiell egal, ob wir Polizisten*innen oder Lehrer*innen, Bäcker*innen oder Männer oder Frauen, biodeutsche oder nicht, schwul oder hetero und was noch sind. Denn es geht um etwas, was uns als (Mit-)Menschen betrifft und um etwas, das in diesem Land mit seiner rechtlichen Verfassung nicht hätte stattfinden dürfen. Aber ich will mich nicht wiederholen.
JONAS ZIPF: Dann lasst uns über den Fokus der Aufarbeitung und konkreten Fragestellung sprechen. Müssen im Mittelpunkt einer neu entstehenden Gedenkkultur rund um den NSU die eigentlichen Morde stehen oder eher die nicht stattgefundene Aufklärung? Neben der von Euch eingangs diskutieren Frage, wie es zu den Morden kommen konnte, trotz aller Warnsignale nach Lichtenhagen, Mölln etc., steht dieser gänzlich andere Ausgangspunkt, der zweiten und dritten Traumatisierung, von denen etwa Şimşeks sprechen. Mit der zweiten Traumatisierung bezeichne ich die direkte Verdächtigung der Opferangehörigen und die jahrelang ausbleibende Ermittlung der Polizei in Richtung eines rassistischen Motivs; mit der dritten Traumatisierung den Zustand der inneren Lähmung und Ohnmacht der Opferfamilien, da die ihnen ab 2012 zugesicherte „lückenlose“ Aufklärung ausblieb. All diese verunsichernden Momente, die Lücken in den Ermittlungen, die Ungereimtheiten, das Verschwinden von Akten, die nicht gestellten Fragen vor Gericht bilden ein in Hanau bereits jetzt wiederkehrendes Muster. Um mit Volkhards Forderung weiterzukommen, frage ich: Welchen Gegenstand soll das Gedenken konkret einnehmen? Soll es um die Morde an und für sich oder um die mangelnde Aufarbeitung danach gehen?
AYŞE GÜLEÇ: Für mich ist das klar: Wir erleben beim NSU-Komplex eine Gewalt nach der Gewalt, die nicht endet und nicht enden will. Erst die Gewalt der Morde selbst. Dann aber sind die Familien selbst kriminalisiert worden, über viele Jahre. Dann gab es das Versprechen nach einer lückenlosen Aufklärung. Das blieb aber heiße Luft! Dann kam der Prozess mit der Hoffnung, jetzt endlich klärt die Justiz auf. Auch das war eine Enttäuschung. Nicht nur eine Enttäuschung, da hat sich die strukturelle Gewalt noch wiederholt, weil dort die Angehörigen ihr Wissen, ihre Analysen überhaupt nicht einbringen konnten, weil sie regelrecht gesilenced wurden in diesem in jeder Hinsicht viel zu engen Gerichtssaal, sodass der Vater von Halit mit einem Bildplakat auftritt, um sein Wissen wenigstens auf einer visuellen Ebene einbringen zu können. Ein Beispiel: Im Abschlussbericht des Oberlandesgerichts München taucht schließlich 66 Mal das Wort „Südländer“ auf. Da frage ich mich: Wo liegt dieses „Südland“ eigentlich? Wir konnten beobachten, dass das Thema des Otherings und der Rassismus im Prozess nicht nur nicht verhandelt, sondern diese Gewaltform dort auch fortgesetzt wird. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen und kann nicht akzeptieren, dass das die Norm sein soll. Und wenn sie es ist, geht es in der Erinnerungsarbeit auch darum, diese rassistische Norm und Normalität oder anders gesagt den Rassismus als Norm und Normalität – also Rassismus als strukturellen Teil von Institutionen – zu thematisieren.
VOLKHARD KNIGGE: Ich will es nicht an Dich zurückspielen, Jonas, aber es ist auch eine Frage an den Auftraggeber solcher Denkmale. Und das bist im Falle des bundesweiten „Kein Schlussstrich!“-Projekts nun mal Du bzw. die Stadt Jena. Es gäbe aus meiner Sicht drei gleichwertige, miteinander verflochtene Stränge. Erstens ist es wichtig und legitim, die Vorgeschichte dieser Verbrechen zu thematisieren: Dass man sie lange voraussehen konnte, durch das, was seit 1990 passiert ist. Da gibt es eine lange Vorgeschichte, nicht nur im Sinne der Rechtsradikalisierung, sondern auch im Abschmelzen, in der Destruktion gesellschaftlicher Solidarität, wie etwa über die Verschärfung des Asylrechts usw. Zweitens ist es genauso legitim und wichtig, sich auf die Würdigung und uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern, mit den unmittelbar Betroffenen, mit den Toten, mit den Ermordeten zu konzentrieren. Und drittens existiert die Sachlage, die Ihr beide jetzt beschrieben habt. Das ist quasi der heißeste Teil. Es geht darum, dass Verbrechen als auch ihre polizeiliche, auch rassistisch grundierte Umdefinition – Stichwort Opfer-Täter-Umkehr – und schließlich die verweigerte, letztlich noch ausstehende umfassende Aufklärung, sehr eng miteinander verbunden sind. In dieser Hinsicht geht es um anhaltende, mehr als beschädigte Gerechtigkeit und die Forderung nach der ganzen Wahrheit. Ich meine, deshalb muss man das Projekt in erster Linie aus dieser dritten Perspektive – mit Berücksichtigung der beiden anderen – denken, entwickeln. Aus der Fokussierung dieser skandalösen blinden Flecken, unvollkommener Aufklärung und der damit verbundenen Fortschreibung akuter Belastungen sowohl der Angehörigen, aber auch der Demokratie, des Rechtsstaates und der demokratischen Gesellschaft insgesamt.
AYŞE GÜLEÇ: Hier frage ich wieder: Wen schmerzt es denn? Lange Zeit gab es eine strukturelle Empathielosigkeit und Ignoranz gegenüber dem Leid derer, die um ihre Angehörigen trauerten. In der Trauer mussten sie sich zudem gegen rassistische Ermittlungen wehren. Sie wussten gleich, dass die Täter Nazis sind. Die Angehörigen und die Überlebenden der Bombenanschläge versuchten immer wieder, ihre Analysen mitzuteilen. Nur wurde ihnen nicht zugehört. Zuhören ist eine aktive Handlung, die lange Zeit ihnen gegenüber verwehrt wurde. Und eigentlich noch schlimmer: Dieses Silencing passierte leider auch im NSU-Prozess.
VOLKHARD KNIGGE: Wir werden immer, Ayşe, die finden, die politische Verbrechen nicht schmerzen, die sie sogar gewollt haben. Es klingt doof, aber das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Wichtig ist für mich der andere Strang, sind die Menschen, die sich das Leid anderer etwas angehen lassen und die dagegen, auch politisch und institutionell angehen. Die muss man stärken und ermutigen, Indifferente trotz allem versuchen zu sensibilisieren und sich gegen die anderen politisch und auch mit den Mitteln des Rechts wehren. Ich verstehe aber das Entsetzen und die Enttäuschung gut, die in Deiner Frage zum Ausdruck kommt.
AYŞE GÜLEÇ: Was ich mag und sehr gut finde an Deinen Ausführungen ist, dass es einen neuen Pfad oder einen Weg beschreibt, der in die Zukunft weist.
JONAS ZIPF: Ich finde sehr gut daran, dass er den Mut erfordert, den heißesten Teil …
AYŞE GÜLEÇ: … anzufassen.
JONAS ZIPF: Ja. Nämlich den, der wirklich noch fluide ist – also das wirklich heißeste Stück des Eisens zu schmieden, während es noch heiß ist, und zu formen. Das berührt vor allem die wiederholte Beschreibung von Ayşe: Diese unendliche Ohnmacht, die man spüren muss, unweigerlich, wenn man erlebt, dass es erst des politischen Mordes an Lübcke bedurfte, bevor etwa ein Innenminister Seehofer die notwendigen Mittel für den Kampf gegen den Rechtsextremismus freigibt und dieses ständige Schielen und Ausweichen im Verweisen auf den hufeisenförmigen Linksextremismus wenigstens mal für eine Weile runterschluckt. Erst jetzt bewegt sich überhaupt ein signifikanter Teil der öffentlichen Debatte und der Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft, und kommt auf den ersten Hauch einer Idee, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Das ist doch die Ohnmacht, die Du beschreibst, Ayşe, nicht zuletzt im Vergleich der Ereignisse in Hessen, angesichts des Wegs von Kassel bis Hanau. Und das berührt der dritte von Dir genannte Punkt, Volkhard, am meisten.
AYŞE GÜLEÇ: Es ist so wichtig, genau da anzusetzen! Dazu braucht es eine kritische Öffentlichkeit. Es braucht uns als kritische Öffentlichkeit. Ich glaube, viele von uns haben aus dem NSU gelernt: So wie beim NSU praktisch sofort aus dem Wort „Döner“ und „Mord“ ein Wort gemacht worden ist und alle Journalist*innen dieser Republik das unreflektiert wiederholt und geschrieben haben, ist es nach den ebenfalls neun Morden in Hanau nicht wieder durchgegangen. Der Focus hatte hier ebenfalls versucht, aus „Shisha“ und „Mord“ ein Wort zu machen. Jetzt wurde aber sofort dagegen agiert, dann hat der Focus zurückgezogen. Was ich damit sagen will: Dass es gar nicht um den NSU, um dieses Trio selbst geht, sondern darum, die rassifizierenden gesellschaftlichen Blicke und Wahrnehmungen zu verändern. Darum geht es. Und es geht auch um folgendes – ich will es gerne mit den Worten von Sara Ahmed sagen: „Solidarität setzt nicht voraus, dass unsere Kämpfe die gleichen Kämpfe sind, oder dass unser Schmerz der gleiche Schmerz ist, oder dass unsere Hoffnung auf die gleiche Zukunft gerichtet ist. Solidarität beinhaltet Engagement und Arbeit sowie die Erkenntnis, dass wir, auch wenn wir nicht das gleiche Gefühl, das gleiche Leben oder den gleichen Körper haben, auf gemeinsamem Boden leben.“
JONAS ZIPF: „Der Schoß, aus dem das kroch, ist fruchtbar noch“– so sagt es Bertolt Brecht und damit möchte ich jetzt den Kreis unseres intensiven Gesprächs schließen. Du hast gerade für mich etwas zusammengefasst, Ayşe, was auch diesen, unseren Gesamttitel „Kein Schlussstrich!“ noch mal eindrücklich unterstreicht und manifestiert. Und Du hast beschrieben, was sich getan und verändert hat auf dem Weg, wohlgemerkt ohne dass dieser auch nur annähernd vorbei wäre, ohne dass Hanau jetzt das alleinig leuchtende Beispiel ist, bei dem nun plötzlich alles positiv läuft. Aber in der Tat: Von „Shisha-Morden“ spricht im Gegensatz zu „Döner-Morden“ keiner mehr. Genauso haben wir erlebt, wie am Abend der Hanauer Attentate in den Tagesthemen noch die Rede von neun migrantischen Mitbürger*innen war, obwohl alle Opfer deutsche Staatsbürger waren, und wie dieser Eindruck in den Medien dann binnen weniger Tage korrigiert wurde. Auch sprechen wir nicht vom Täter, kaum einer kennt seinen Namen, im Gegensatz zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe.
AYŞE GÜLEÇ: Das haben wir den Kämpfen der Hinterbliebenen sowie den vielen antirassistischen, antifaschistischen sowie investigativen Journalist*innen und einer kritischen Öffentlichkeit zu verdanken!
JONAS ZIPF: Genau so ist. Und deswegen versuche ich, diesen Kreis zu schließen, indem ich auf die Fragen meines Sohns zurückkomme. Ihr werdet jetzt lachen, ich erfinde das nicht für das Gespräch, aber er hat ja danach gefragt, was mit dem Schreiber des Königs ist, Ihr könnt Euch erinnern – der König, der, wenn die Menschen ihn nicht mehr wollen, verjagt wird; der König, der nur einen Schreiber hat, der aufschreibt, welche Geschichte es gab: und der Schreiber, der ebenfalls verjagt wird von den Leuten, wenn sie nicht mehr zufrieden sind, mit dem, was er aufschreibt. Jetzt haben wir, glaube ich, gelernt, dass es sehr wohl darauf ankommt, dass es im Laufe einer zähen und langen Geschichte unverhandelbare universalistische Werte gibt. Das ist eine Grundlage. Und die ist normativ, diese Grundlage.
Aber ganz am Ende hat mein Sohn mich gefragt, ob es denn auch Schreiberinnen gab. Und plötzlich bin ich mir sicher: Die Art und Weise des Schreibens, um bei meinem Sohn zu bleiben, die sollte doch nach Möglichkeit einer Mehrheit der Menschen so gerecht werden, dass diese den Schreiber nicht verjagen. Sonst wäre auch mein Sohn nicht zufrieden.
Ayşe Güleç und Volkhard Knigge lachen.
Ayşe Güleç, geb. 1964 und aufgewachsen im Ruhrgebiet, ist Diplom-Sozialpädagogin, Autorin und forschende Aktivistin an den Schnittstellen Antirassismus, Migration, Kunst, Kunstvermittlung. Sie war Community Liaison bei der documenta 14 und leitete die Kunstvermittlung im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt a.M. Sie gilt als eine der Initiatorinnen des NSU-Tribunals. Sie engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und Gewalt. Als wichtige Figur innerhalb der migrantischen Community wirkt sie als Knotenpunkt für viele der durch den NSU betroffenen Familien. Von 1998 bis 2016 leitete sie im Kulturzentrum Schlachthof Kassel die Entwicklung, Leitung und Durchführung von interkulturellen-ästhetischen Aktivitäten, Bildungsangeboten und für lokale, regionale und europäische Vernetzungsarbeit.
Volkhard Knigge, geb. 1954 in Bielefeld, Historiker, Geschichtsdidaktiker, Ausstellungsmacher. 1986 geschichtsdidaktisch-psychoanalytische Promotion zu „trivialem“ Geschichtsbewusstsein. Wiss. Mitarbeiter an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, dem Kulturwissenschaftlichen Institut des Wissenschaftszentrums NRW und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Lehrstuhl Prof. Dr. Lutz Niethammer). 1994 Berufung zum Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, ab 2008 auch Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Neukonzeption der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Zahlreiche Forschungskooperationen und Ausstellungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, gesellschaftliche Funktionen und Gremienmitgliedschaften, nationale und internationale Auszeichnungen.
Jonas Zipf, geb. 1982 in Darmstadt, arbeitet seit 2016 als sog. Werkleiter von JenaKultur, des städtischen Eigenbetriebs für Kultur, Kulturelle Bildung, Tourismus und Marketing in Jena. In seiner Funktion ist der studierte Psychologe, Musik- und Sprechtheaterregisseur der Kulturverantwortliche der Stadt Jena und initiiert Kulturprojekte und stadtgesellschaftliche Prozesse wie „72 Stunden Urban Action Lobeda“ oder auch „Kein Schlussstrich!“. Vor diesem Engagement war er nach seinem Studium in Berlin, Paris und München als Dramaturg und Schauspieldirektor u.a. am Thalia Theater Hamburg, dem Theaterhaus Jena und dem Staatstheater Darmstadt tätig.
Welcher der drei Standpunkte überzeugt Sie am meisten? Wir freuen uns auf Ihre Feedbacks, aber auch, wenn Sie unsere zahlreichen Veranstaltungen zum NSU-Komplex besuchen und dort mit uns diskutieren. Sie bieten viele Perspektiven auf diese ungeheuerliche Mordserie, auf bittere Versäumnisse und unverzeihliche Kontinuitäten. Aber vor allem bemühen sie sich, die Opferperspektiven offen zu legen.
Hier geht es zur gesamten Publikation!