Osterspaziergang mit Hartmut Rosa und Jonas zipf
Verehrte Leser*innen unseres Blogs,
gestern haben wir Sie auf Goethes poetischen, uns allen wohl bekannten, immer wieder neuen Osterspaziergang mitgenommen; heute laden wir Sie zu einem anderen ebenso geistreichen, dieses Mal virtuellen Osterspaziergang ein. Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa und unser Werkleiter Jonas zipf disputieren plaudernd über viele Fragen, die uns in diesen Zeiten bewegen. Und sie kommen zu Resümees, die wiederum neue Gedankenräume eröffnen. Sie tun es in der Form, die uns in kürzester Zeit und ein bisschen unfreiwillig so vertraut geworden ist: in einer Telefonkonferenz.
Im ersten spontanen Impuls wollten wir das Gespräch auf eine blog- und internetfreundliche Länge kürzen, aber dann fanden wir, dass es jetzt an der Zeit ist, sich die Zeit zu nehmen. Wenn nicht inmitten dieser Krise, an Ostern, wann dann?!
Aber bitte – Lesen Sie einfach selbst.
Teil 1
JONAS zipf: Wenn du jetzt hier gewesen wärst in Jena, dann wären wir vielleicht durchs Paradies gegangen…
HARTMUT ROSA: …hätten wir wirklich gut machen können, ja schade…
JONAS zipf: … zu zweit dürfen wir ja noch. Aber so bist du jetzt im Schwarzwald, was auch sehr gut ist, und ich bin in Jena. Und deswegen ist es jetzt ein virtueller Spaziergang, und für den Leser wird es das sowieso.
Warum Osterspaziergang? Weil ich finde, in der deutschen Geistesgeschichte hat Ostern neben der religiösen Bedeutung noch eine ganz andere Bedeutung. Spätestens seit dem Osterspaziergang bei Goethe ist das eigentlich so ein Moment des Innehaltens und des Zu-sich-Kommens. Und im Moment reden ja alle davon, dass dies eine Zeit ist, in der die große Einkehr stattfindet. Das ist das große Thema. Und du bist viel gefragt in diesen Tagen, kann ich mir vorstellen. Also, ich stelle mir vor: Gott und die Welt will mit Hartmut Rosa über Entschleunigung und Resonanz und Verfügbarkeit reden.
Hartmut Rosa (lacht): …Der Liebe Gott hat bei mir noch nicht angerufen…
JONAS zipf: Immerhin ist ja Ostern. Daher finde ich, dass unser Gespräch jetzt ganz bewusst auch ein intellektuelles Gespräch sein darf. Sonst leben wir ja in einer sehr intellektfeindlichen Zeit. Alles muss immer so medial wirksam verkürzt werden, vor allem in meinem momentanen Feld, in der Verwaltung, in der Politik. Und das finde ich ganz schön fahrlässig. Deswegen steige ich mit einem Gedicht von Paul Celan ein.
HARTMUT ROSA: Okay.
JONAS zipf: Das wirst du nicht kennen. Ich habe das gefunden am Wochenende, weil ich in den Briefen von Ingeborg Bachmann und Paul Celan gestöbert habe. Und sie weist ihn darauf hin, dass er ein Gedicht geschrieben hat mit dem Titel: Corona.
HARTMUT ROSA (lacht): Echt? Ja, okay.
JONAS zipf (rezitiert Paul Celan):
Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.
Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.
Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
es ist Zeit, dass man weiß!
Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt,
dass der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, dass es Zeit wird.
Es ist Zeit.
Das ist das letzte Gedicht, das Paul Celan vor der „Todesfuge“, seinem wahrscheinlich berühmtesten Gedicht, geschrieben hat. Und gewissermaßen ist es der größte Kontrast, den man sich vorstellen kann. Das „Corona“-Gedicht steckt voller Hoffnung und innerer Einkehr und Zeit und Begegnung und Zärtlichkeit. Und die „Todesfuge“ ist dann die Beschreibung der maximal größten Dystopie, die man sich vorstellen kann, dem Tod im Konzentrationslager. Und zwischen diesen beiden Gedichten liegen 24 Stunden.
Und das ist quasi meine Einstiegsfrage. In diesem jetzigen Moment, Corona, friert alles ein: vermeintlich werden ganz viele Hoffnungen und Ängste formuliert und laut. Und ich frage mich wirklich, ob wir jetzt alle Angst haben müssen, zu sterben? Ist jetzt die Zeit für die großen Dystopien? Oder doch für die großen Utopien? Das 20. Jahrhundert ist schon einen Moment vorbei. Das ist ja etwas, wonach du jetzt ganz viel und ganz oft gefragt wirst: Ist es eine hoffnungsfrohe Zeit? Oder ist es eine ängstliche Zeit? Müssen wir Angst haben oder können wir Hoffnungen hegen?
HARTMUT ROSA: Ich meine, wie das Celan-Beispiel ja wirklich deutlich und klar zum Ausdruck bringt, liegen die beiden auch sehr, sehr eng beieinander. Da, wo die Hoffnung stark ist, kann auch die Angst stark sein und umgekehrt. Und deshalb denke ich, es gibt vielleicht Zeiten, in denen sich Dinge intensivieren. Und in so einer Zeit können wir gerade durchaus leben. Natürlich gibt es starke Ängste, einerseits Ängste vor der Krankheit oder gar vor dem Tod und andererseits starke ökonomische Ängste. Aber tatsächlich bin ich dafür, darin auch durchaus utopisches Potenzial zu sehen. Ich glaube, Gesellschaften erreichen manchmal so Punkte, an denen ihre Routinen, die eingespielten Pfade irritiert werden. Und wir sind definitiv an so einem Punkt, in allen möglichen Hinsichten. Eigentlich würde ich sagen, waren wir es auch schon vor Corona. Aber die Pfade waren noch tief genug, wir konnten die Gleise nicht verlassen. Und diese Krise ist jetzt irgendwie so radikal, dass da wirklich das Potential drinsteckt, auch Neues daraus hervorgehen zu lassen. Das ist irgendwie für mich Hannah Arendts Idee: die Besonderheit des Menschen ist Natalität[1]. Wir können auch noch mal neu anfangen.
JONAS zipf: Die Besonderheit des Menschen ist die Natalität. Gleichzeitig sagst Du, das ist jetzt eine Zeit, die besonders intensiv ist. Was macht denn diese Zeit so intensiv? Einfach nur der Tod, der plötzlich für uns präsent wird? Oder ist es noch mehr als der Tod, die Besonderheit der Natalität? Was macht diese Zeit so intensiv, dass da eine Hoffnung zum Vorschein kommt, um mit Ernst Bloch zu reden?
HARTMUT ROSA: Naja, also es ist ja auch für unseren Alltag so, dass die eingespielten Routinen nicht mehr funktionieren. Und übrigens auch, dass unsere Weltreichweite, die für mich ja theoretisch ein wichtiges Konzept ist in vielerlei Hinsicht auch ganz stark eingeschränkt ist. Wir sind verkürzt auf den Nahbereich. Wir sind uns selber ausgesetzt und unseren Nächsten. Und das ist durchaus nicht immer angenehm. Und übrigens machen wir da jetzt auch sehr missliche Erfahrungen: wir stellen fest, dass die Dinge, von denen wir immer dachten, dass sie uns besonders wichtig seien und dass wir sie auf jeden Fall tun würden, wenn wir mal Zeit hätten (z.B. dann setze ich mich mal wieder ans Klavier oder nehme mal wieder Goethe zur Hand), bei Weitem nicht so schön sind, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das heißt, wir müssen uns die Resonanzachsen, die wir wirklich haben, noch mal neu überlegen. Aber ich glaube, die Intensivierung kommt dadurch, dass die eingespielten Routinen weg sind und wir manchmal jetzt Freiräume haben, zeitliche Freiräume, bei denen wir nicht einfach To-do-Listen abhaken. Normalerweise laufen wir ja von einer Aufgabe zur anderen, Alltagsbewältigungs-Verzweiflungsmodus. Und jetzt können wir gerade nicht laufen, obwohl wir gerne in digitale Welten flüchten.
JONAS zipf: Das ist ein bisschen so, wie man auch die Ferien oder den Urlaub beschreiben könnte. Wenn ich in Urlaub fahre, dann tut sich quasi erstmal eine ganz große Intensität auf. Nachher erleben wir dann die Zeit als gedehnt. Oftmals können wir uns an drei Wochen Urlaub viel intensiver und detailreicher erinnern als an die drei oder fünf Monate davor und danach. Diese Empfindung wird dann vielleicht im Laufe von drei Wochen wieder weniger, wenn wir wieder neue Routinen entwickelt haben. Das könnte ja auch jetzt der Fall sein, wenn das Ganze länger anhält. Welche Rolle spielt denn aber dabei das kollektive Erlebnis? In Deutschland sind wir das ja nicht mal in unseren Ferien wirklich gewohnt. Der einzige Zeitpunkt im Jahr, zu dem ich sicher sein kann, dass die anderen auch alle Pause haben und vermeintlich nichts tun oder weniger oder andere Dinge tun, um bei dem Routine-Bruch zu bleiben, das ist die Weihnachtszeit. Das, was wir so schön „zwischen den Jahren“ nennen. Im Gegensatz zu Gesellschaften wie der italienischen oder der französischen, die das auch im Sommer kennen, wenn wirklich alle auf einmal zur gleichen Zeit synchron in den Urlaub fahren und wissen: Was ich bis zum August nicht erledigt habe, das muss bis zum September warten. Aber dieses Momentum jetzt ist ja auch sehr kollektiv. Wir wissen und imaginieren, dass alle die Anderen auch im Wohnzimmer sitzen. Und wenn wir auf den Balkon gehen um 18:00 Uhr und Musik machen oder um 17:00 Uhr applaudieren, dann suchen wir die anderen auf dem Balkon gegenüber. Was spielt das für eine Rolle bei der Intensität?
HARTMUT ROSA: Zunächst mal würde ich sagen, wie Urlaub ist das nicht. Ich glaube, wenn wir das sagen, kriegen wir Ärger. (lacht) Ich habe mir sowieso schon Ärger eingehandelt, weil ich angeblich die Krise in zu schönen Farben male. Und wenn wir sagen, Corona ist wie Urlaub, dann muss man da natürlich drei Dinge, glaube ich, abziehen. Da ist zum Einen die Angst, die wir schon hatten, die Angst vor Krankheit, die Angst auch vor ökonomischem Druck. Das ist natürlich eine andere Erfahrung als die Urlaubserfahrung. Es ist ein Moment von Zwangsentschleunigung, denn es ist ja nicht unsere Entscheidung, dass wir jetzt mal aussetzen, sondern wir sind irgendwie auch dazu gezwungen worden. Das macht schon was aus. Und dann ist es ja auch so, dass wir im Urlaub sehr häufig wegfahren. Gerade die Ausdehnung der räumlichen Weltreichweite ist ein entscheidendes Merkmal von Urlaub. Und jetzt schrumpft unsere Weltreichweite massiv. Ich glaube, das könnte der interessanteste Aspekt dieser Erfahrung sein, dass ich plötzlich räumlich eingeschränkt bin, im Wesentlichen auf meine Wohnung oder allenfalls meine Stadt, meine Umgebung. Und auch zeitlich kann ich nicht mehr länger als zwei oder drei Wochen denken. Insofern ist es anders als Urlaub. Ich glaube tatsächlich, dein Hinweis auf die Zeit „zwischen den Jahren“ könnte was haben, weil wir da häufig ähnliche Erfahrungen machen. Das alte Jahr ist vorbei, das neue hat noch nicht richtig angefangen. Und da sind wir auf einem kleinen Inselbereich angewiesen. Was ich interessant finde, ist die Sache mit der Kollektivität. Einerseits könnte man sagen, wir machen die Erfahrung ja alle einzeln, weil wir gerade Kontaktverbot haben, an das sich Leute ja auch wirklich halten. Aber andererseits passiert was Hochinteressantes: dass wir nämlich eigentlich zum ersten Mal seit langem, langem das haben, was man Joint Attention nennen kann, und zwar weltweit. Corona ist in jedem einzelnen Bewusstsein, und auch die Besonderheit der Lage ist in jedem Bewusstsein immer schon da. Wir haben im Moment alle die gleiche Erfahrung, … nicht nur dann, wenn wir ein Balkonkonzert oder so etwas machen, sondern ganz generell. Das ist ganz interessant als kollektive Erfahrung. Da misst sich Kollektivität und Vereinzelung noch mal auf ganz neue Weise.
JONAS zipf: Das würde bedeuten, dass wir uns dann auch als Gemeinschaft fühlen, ja, weil wir im selben Zeitpunkt dasselbe erleben? Das ist etwas anderes als Weltreichweite, klar. Aber das sind Zeitpunkte, die als historische Momente erlebt werden, so wie die Mondlandung oder ein bedeutsames Fußballspiel. Alle wissen, zu diesem Zeitpunkt machen die anderen genau dieselbe Erfahrung, jetzt in genau diesem Moment. Und das stiftet dann wieder eine virtuelle Gemeinschaft.
HARTMUT ROSA: Ja. Beim Fußball ist es ganz offensichtlich so. Nur gibt es natürlich auch Fußballhasser oder die, denen das gleichgültig ist. Aber Fußball ist ein gutes Beispiel dafür, weil man dann von Joint Attention sprechen kann. Alle Augen sind beim Elfmeter auf den Ball gerichtet. Und man erlebt Joint Emotion. Das heißt, die Anhänger der einen Mannschaft fühlen alle das Gleiche: Hoffentlich geht der Ball rein. Und die der anderen Mannschaft haben sozusagen Reverse Emotions: Hoffentlich geht der Ball nicht rein. Das ist eine unglaubliche Bündelung. Es ist nicht ganz passend, weil Corona ein größeres und viel diffuseres Phänomen ist. Aber es ist interessant, dass es alle betrifft. Es ist interessant und sehr komplex, wie sich das Verhältnis zu den anderen Menschen, also zu den Mitmenschen, zur Gemeinschaft, gerade verändert. Weil auf der einen Seite, jede Krise, wie wir sie gerade durchleben, immer auch das Potential hat, Solidarität und Gemeinschaft zu stiften. Und zwar einfach deshalb, weil es jetzt eben nicht die eine Behörde gibt für vielerlei Fälle oder Probleme oder die Institution oder das Geschäft, das professionell ein Problem löst. Da muss man sich gemeinsam überlegen: Wie machen wir das denn jetzt? Und man stellt gerade fest, überall muss improvisiert werden: Was finden wir denn für eine Lösung? DAS stiftet Gemeinschaft. Andererseits ist es so, dass das Virus natürlich eine unsichtbare Gefahr ist, die eine Tendenz, die in unserer Gesellschaft sowieso zu beobachten ist, noch verstärkt, nämlich das Misstrauen gegenüber allen anderen. Der Mann, der da vorbei geht oder das Kind, das da im Garten spielt, könnten tendenziell eine tödliche Bedrohung tragen und mich damit infizieren. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich vielleicht schon selber infiziert bin. Das verstärkt Misstrauen. Der ANDERE: man fühlt es fast physisch. Wenn in einem Geschäft oder sonstwo ein Anderer zu nah kommt, schreckt man geradezu körperlich zurück. Das ist natürlich ein tendenziell sozialfeindliches Moment. Und als Soziologen müssen wir sagen: „Lass mal gucken, was daraus noch entsteht.“ Es gibt dystopische und utopische Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten. Was sich durchsetzt, steht ja nicht fest. Es ist kein Naturgesetz. Deshalb habe ich auf Hannah Arendt und Natalität hingewiesen. Das hängt jetzt von uns ab, was wir daraus machen. Und da würde ich sagen, lass uns versuchen, das so zu nutzen, dass sich utopische Potentiale entfalten.
JONAS zipf: Das wäre auch historisch in dem Sinne, dass die Geschichte formbar ist, also dass es ein sehr offener Moment ist, der formbar ist.
HARTMUT ROSA: Ja.
JONAS zipf: Du hast jetzt aber auch eine Paradoxie beschrieben. Diese Paradoxie, dass Solidarität, und jetzt haben wir auch gesagt, Gemeinschaft letztlich über Abstand entsteht. Nicht nur in der körperlichen Begegnung im Supermarkt, sondern die größte Intensität zur Gemeinschaft entsteht im Moment über Skype, Zoom und Co., etwa, wenn Igor Levitt abends Konzerte spielt und Tausende schauen quasi im Sicherheitsabstand des virtuellen Raums zu. Welche Rolle spielt dabei der Staat? Wir haben ja eigentlich eine Zeit, in der diese großen Erzählungen, Utopien, Dystopien, gar nicht mehr so zeitgemäß schienen. Da war lange vom Ende der Geschichte die Rede. Und jetzt plötzlich muss der Staat es richten. Er muss die Krise bewältigen. Viele, viele, die dem Staat misstraut haben, viele Liberale, auch in der Wirtschaft, schreien nun förmlich nach dem Staat. Die Umfragewerte für die Parteien, die jetzt die Krise managen, schießen durch die Decke. Der Staat erfährt einen Vertrauensgewinn. Kann man das so sagen? Stimmt das? Ganz plötzlich heißt es wieder, es können Unternehmen teilverstaatlicht werden. Das soll ein Teil der Rettung für diese schwierige Situation sein, und so weiter und so fort.
HARTMUT ROSA: Ja, das ist schon ganz interessant. Ich denke, dass es durchaus zu einer Neujustierung der gesellschaftlichen Verhältnisse führen kann. Der Nationalstaat scheint im Moment der große Gewinner zu sein. Aber man muss vielleicht auch mal gar nicht in Gewinnern oder Verlierern denken. Was man dennoch sieht: Dass es wichtig ist, eine Instanz zu haben, durch die wir kollektiv handeln können und auch handlungsfähig sind. Und das kann eben nicht der Markt sein. In Krisenzeiten braucht es Koordination, Stärke, Handlungsfähigkeit. Es ist ein bisschen bedauerlich, dass dabei die internationalen Organisationen gerade eher unterzugehen scheinen. Die EU zum Beispiel, die es bisher immer noch nicht geschafft hat, auch Corona-Bonds als Zeichen der Solidarität durchzusetzen. Nationalstaatlicher Egoismus könnte eine Schattenseite davon sein. Aber dass man kollektiv handeln kann, ist eine wichtige Erfahrung; der Staat sind ja nicht irgendwelche anderen Menschen, die in Ämtern sitzen, sondern er ist unser Organ, durch das wir Handlungsfähigkeit erfahren. Und ich finde, genau das erleben wir jetzt in einer Weise, wie wir es uns nicht hätten träumen lassen. Ich meine, es ist ja nicht das Virus, was diese ganzen Hamsterräder anhält. Man muss sich das mal überlegen: der Verkehr, zum Beispiel Flugverkehr, ist fast zum Erliegen gekommen. Das hätten wir doch für vollständig unmöglich gehalten. Niemand kann den ganzen Luftverkehr innerhalb von wenigen Tagen anhalten! Aber wir konnten es sozusagen als politisch Handelnde. Und ich glaube, diese Erfahrung ist wichtig und die ist auch gut. Und ich vermute auch, dass es zu einer Neujustierung dann kommt, übrigens auch im Blick auf Staat und Markt, auch auf Eigentumsverhältnisse. Dass es vielleicht keine so gute Idee ist, das Gesundheitssystem zu privatisieren und dann sozusagen einfach auf just-in-time und maximalen Profit zu eichen, was bedeutet, dass, wenn es drauf ankommt, die Beatmungsgeräte nicht da sind. Ich kann mir vorstellen oder ich hoffe eigentlich sogar, dass politische Handlungsfähigkeit dadurch mal an Kraft gewinnt, auch für die Zukunft an Kraft gewinnt und dass Märkte stärker eingebettet werden in politische und auch kulturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge.
JONAS zipf: Da spiele ich mal den Antipoden und sage, das ist sehr optimistisch. Könnte es denn auch sein, dass die Gewinner, wenn wir jetzt doch mal kurz über Gewinner und Verlierer reden, diejenigen sind, die den Nationalstaat stark machen, die Multilateralismus schwierig finden, die Globalisierung kritisieren, die die Grenzschließung gut finden, und die vor allem bezweifeln, ob wir in der Lage sein werden, mit Demokratie und Föderalismus mit so einer Krise umzugehen? Ist das überhaupt möglich? Brauchen wir nicht eigentlich den starken Entscheider? Und ein bisschen gerieren sich ja auch einzelne Politiker bei uns so wie starke Entscheider. Sie müssen quasi fast täglich unter Beweis stellen, dass ihr Staat, also unser Staat in Deutschland, genauso handlungsfähig ist wie eine Diktatur in China, ein Land, das jetzt schon ein großer Propaganda-Gewinner ist. Was ich sagen will, am Ende des Tages, auch wenn es im Moment nicht so scheint, was die Umfragewerte anbelangt, könnten die Populisten in Europa, und auch die AfD in Deutschland, doch als die großen Sieger vom Platz gehen?! Viele Themen sind eigentlich ihre Themen, zahlen auf ihre Münze ein. Die Grenzen müssen geschlossen werden, wir brauchen weniger globalisierte Zusammenhänge, „migrantische Ströme“, wie es dann so diffamierend heißt: Wir müssen die Wirtschaft wieder kontrollieren, wir brauchen eine autoritären starken handlungsfähigen Staat. Am Ende des Tages habe ich manchmal die Sorge, es könnte eigentlich so ein Moment des kollektiven Traumas werden. So wie es die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren war. Eine kurze Zeit lang halten alle zusammen und tun das, was erforderlich ist; es herrscht Solidarität und Vernunft. Und danach beginnen lange, lange Auseinandersetzungen politischer und juristischer Natur, die problematisieren, was in dieser Situation an vermeintlichen Fehlern gemacht wurde. Und die Profiteure sind die, die sich außerhalb dieses scheinbaren Meinungsblocks positionieren können. Ich habe Befürchtungen, dass die starken Gewinner dieser Krise die Populisten sein könnten.
HARTMUT ROSA: Diese Befürchtung habe ich tatsächlich auch. Ich habe tatsächlich auch ganz früh gedacht, das erinnert mich fatal an, wie du es auch wahrgenommen hast, an die Situation 2015, in der erstmal eine große Solidarität und eine Willkommenskultur herrschten, in der man das Gefühl gewann, da gehe ein Ruck durch die Gesellschaft, der sehr positiv ist. Und ich war damals schon ziemlich skeptisch, weil ich dachte, das kann doch irgendwie nicht sein, dass die Gesellschaft sich plötzlich in so kurzer Zeit so verändert hat. Und das hatte sie ja dann auch nicht. Zu dem, was du gesagt hast, kann man ja noch hinzufügen: Guck dir Orbán an, in Ungarn, der ja wirklich praktisch jetzt eine autokratische Herrschaft errichtet. Oder die Zustimmung zur Überwachung mit Handy-Tracking steigt auch. Man kann sich allerhand dystopische Szenarien ausdenken. Aber ich finde, eigentlich will ich gar nicht so über die Krise nachdenken. Es ist kein Naturgesetz, was da kommt. Das ist mir im Moment das Wichtigste. Wir sollten nicht darüber nachdenken, ob es nicht auch ganz schlimm werden könnte, sondern wir sollten versuchen, zu handeln. Ich glaube schon, es gibt nicht viele historische Punkte, an denen eine Situation offen ist. Was daraus hervorgeht, steht nicht fest. Und selbst wenn ich der beste Soziologe der Welt wäre, könnte ich jetzt nicht genau sagen, ob die AfD gewinnt oder die Linke oder sonst jemand, denn es gibt kein Gesetz, das dies bestimmt und das man nur erkennen müsste Aber ich glaube, es geht nicht darum, richtig vorherzusagen, sondern richtig zu handeln. Und ich denke, das Wichtigste, um das zu vermeiden, was du da beschreibst, ist, dass man den Staat nicht als „das Andere“ versteht. Ich glaube, das ist eine fatale Entwicklung der letzten 100 oder 50 Jahre, dass Menschen den Staat als eine Instanz außerhalb ihrer selbst wahrnehmen. Der Staat ist unser kollektives Handlungsorgan. Und wenn wir den in eine autoritäre Instanz verwandeln, die uns gegenübersteht und uns kontrolliert, dann haben wir die Idee demokratischer Selbstbestimmung natürlich komplett verraten und vergessen und würden deshalb zittern, wie das Kaninchen vor der Schlange, dass vielleicht am Ende doch die AfD oder sonst jemand, irgendwelche rechtspopulistischen und autoritären Herrscher gewinnen. Sondern ich glaube, es geht jetzt darum, Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, gerade auch im Blick zum Beispiel auf die Klimakrise. Ich finde, da gibt es natürlich einen Zusammenhang, denn die Krise ist ja jetzt nicht erst durch Corona entstanden. Wir hatten davor schon Krise und haben uns da immer als vollständig ohnmächtig erlebt. Wir können noch so viele Klimagipfel und Klimakonferenzen und Klimaziele formulieren oder abhalten: Wenn wir dann zum Beispiel Verkehrsströme ansehen – jedes Jahr mehr Autos, mehr Flugreisen, mehr Lastwagen, mehr Containerschiffe, mehr Kreuzfahrten- dann sehen wir wieder eine einzige exponentielle Wachstumskurve. Und jetzt gerade machen wir die Erfahrung, wir können das innerhalb weniger Tage anhalten, und zwar politisch. Es ist nicht das Virus, sondern das ist politisches Handeln, das das bewirkt hat. Und diese Erfahrung, die durchaus positiv ist, sollten wir nutzen, statt jetzt vor Angst, dass es am Ende doch wieder schief gehen könnte, zu erstarren.
JONAS zipf: Okay. Dann lass uns über die Rollen sprechen, die Wissenschaft und Kultur einnehmen, wenn es darum geht, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren. Es ist ja im Übrigen fast eine Metapher, ja. Wenn du davon sprichst, bleiben wir mal bei dem Begriff des Wachstums, dass wir anders keinen Ausstieg aus dem Zwang der Wachstumslogik gefunden haben, außer durch das Virus, das uns jetzt ja quasi fast metaphorisch dazu zwingt. Darum geht es ja beim berühmten „Flattening of the Curve“: das Wachstum eindämmen! Also, dass eine ganze Gesellschaft daran arbeitet, ein Wachstum einzudämmen, …
HARTMUT ROSA: Das stimmt.
JONAS zipf: … das hast du als Post-Wachstumforscher oder -theoretiker nicht zu träumen gewagt. Und das sozusagen wirklich als zentrale Metapher. Wir müssen das Wachstum zurückfahren. Wie können wir darauf, auch über diese Zeit hinaus, mit Mitteln der Geistes-Wissenschaft reagieren? Wie kommt man aus dem Kreis der eigenen Echokammer jetzt tatsächlich in die Wirksamkeit, in die Erscheinung rein, die dafür sorgt, dass wir das offene Momentum gestalten, die Welle surfen, und an dem festhalten können, an dem großen Interesse, das zum Beispiel deine Arbeit jetzt gerade noch mal zusätzlich erfährt. Wie kriegen wir das in den Alltag übersetzt? Wenn es vorbei ist, wenn jetzt dann irgendwann das Leben wieder hochfährt, so wie die Wirtschaft es fordert, so schnell wie möglich, wie kriegen wir den Transfer hin?
HARTMUT ROSA: Das ist die wahnsinnig schwierige Frage. Die schwierigere Hälfte haben wir noch nicht geschafft. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, du hast schon Recht: es geht bei Corona eigentlich darum, Wachstum einzuschränken, also das Wachstum der Infektionszahlen, aber das ist natürlich ein sehr spezifisches. Wir haben diese wahnsinnigen anderen Beschleunigungsräder, Wachstumsräder angehalten. Wir haben die Gesellschaft angehalten, was wir uns niemals zugetraut hätten. Aber damit haben wir eigentlich nur einen Unfall verursacht. Weil: wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die steigerungsabhängig, steigerungsbasiert ist. Wir müssen jedes Jahr schneller sein, mehr produzieren, innovativer sein, damit wir das bestehende System erhalten können. Und jetzt haben wir dieses System angehalten. Ich glaube, das haben wir wirklich, wenngleich allerdings nicht in der digitalen Dimension – im Netz drehen sich die Räder gerade schneller als je zuvor. Es ist jetzt aber natürlich noch kein neues System, das ist eigentlich nur ein Crash. Es ist so, wie wenn du ein Fahrrad anhältst. Wenn das nicht abgestützt wird, dann fällt es halt um. Und die Frage ist, wie kann denn jetzt ein neues System aussehen. Da hast du Recht: Die große Gefahr, der wahrscheinliche Fortgang der Geschichte ist, dass sobald diese tödliche Gefahr verschwunden ist, wir wieder anfangen, wir versuchen werden, die alten Räder wieder in Gang zu bringen, die Maschine wieder anzuschieben. Und möglicherweise erleben wir dann auch einfach einen ökonomischen Wachstumsschub, wie nach Kriegen oder so. So dass wir am Ende eben wieder genau da sind, wo wir vorher auch waren. Und das finde ich deshalb nicht besonders attraktiv, weil wir vorher schon in massiven Krisen waren, in ökologischen Krisen, psychologischen Krisen, politischen Krisen. Wir waren im Aggressionsmodus gegenüber der Welt. Und was wir jetzt erfahren, ist, dass man die Räder schon anhalten kann. Als Soziologe, der sich auch als Kulturwissenschaftler versteht, finde ich das ganz interessant, zu überlegen, was wir da eigentlich gerade tun. Die Frage, die mich beschäftigt, ist die: Was genau hat eigentlich diese unglaubliche Bremskraft erzeugt? Weil, wie wir aus der Physik wissen, wenn du eine gewaltige Bewegung bremsen oder anhalten willst, brauchst du ja wahnsinnige Kraft. In der Regel sind es Reibungskräfte oder Reibungsenergien, die dann freigesetzt werden. Und die Frage ist, was befeuert denn diese Kraft, diese Bremsenergie? Meine Antwort auf die Frage ist, dass es eigentlich dieses wahnsinnige Verlangen der Gesellschaft ist, Verfügbarkeit herzustellen. Wir wollen die Welt erreichbar haben, wir wollen sie vor allem auch im Griff haben, kontrollieren und beherrschen. Und Corona ist nun im Kern so ein Monster der Unverfügbarkeit. In meinem kleinen Unverfügbarkeits-Buch heißt das letzte Kapitel: Die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster. Es sagt, dass letztendlich der Versuch, die Welt grundsätzlich unter Kontrolle zu bringen, immer Rückschläge erzeugt, wo plötzlich monströse Unverfügbarkeit erscheint. Zum Beispiel hat unser erfolgreicher Versuch, das Atom zu spalten, also Macht über das Innerste der Materie auszuüben, monströse Unverfügbarkeit hergestellt, wie wir sie in Tschernobyl oder Fukushima oder auch Hiroshima gesehen haben, dass nämlich, wenn atomare Strahlung freigesetzt wird, sie uns eigentlich nur töten kann. Man kann mit einer Atombombe nicht in Resonanz treten. Wir können sie nicht kontrollieren, nicht in den Griff kriegen. Und Corona haben wir wissenschaftlich noch nicht erforscht, wir haben es medizinisch nicht im Griff, wir können es weder heilen noch dagegen impfen, wir können es politisch schlecht regulieren, wir haben radikal die Grenzen geschlossen, und nicht mal das hilft offensichtlich, die ökonomischen Folgen sind unübersehbar. Wir haben es mit der Erfahrung zu tun, dass uns der Versuch, Welt zu kontrollieren und zu beherrschen, in monströse Unverfügbarkeit umschlägt. Und meine Hoffnung wäre jetzt, deshalb diese lange Ausführung, dass wir ein anderes Verhältnis gewinnen zum Leben, zum Sinn vom Leben. Meine Diagnose in dem Unverfügbarkeits-Buch lautet, dass wir eigentlich Leben abtöten. Und deshalb sind so viele Menschen so frustriert und so unzufrieden, obwohl sie ganz viele Dinge und viel Geld und viele Möglichkeiten haben. Und meine Frage war immer, woher das kommt. Ich glaube, weil diese Verfügbarkeitsideologie auch eine institutionalisierte Seite hat: Wir müssen alles rechtlich absichern, wir müssen uns versichern und garantieren lassen, und so weiter. Also meine Hoffnung wäre, die Erfahrung, die daraus entsteht, bestünde in einem neu gewonnenen Verhältnis zu dem, was Leben eigentlich heißt. Weil ich schon glaube, dass Corona uns genau das zeigt: Was ist eigentlich Leben? Ist das Wichtigste, möglichst lange zu leben? Oder ist das Wichtigste, Tod und Krankheit herauszuschieben? Oder gibt es vielleicht auch noch eine andere Dimension von gelingendem Leben, das mit Unverfügbarkeit und auch Risiken anders umgeht? Ich glaube, wir müssen in so eine Richtung denken, auch wenn wir fragen: „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ – und zwar nicht nur im Blick auf andere Verteilungsmuster oder andere institutionelle Ordnungen.
JONAS zipf: Da sind wir jetzt im Kernpunkt. Da haben wir auch angefangen. Das sei die Zeit, hast du gesagt, in der man zu den Dingen kommt, zu denen man sonst nicht kommt. Und das ist aber dann plötzlich auch ganz schnell viel, viel anstrengender, als man sich das vorgestellt hat.
HARTMUT ROSA: Ja.
JONAS zipf: Das Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Das Klavierstück, das ich schon lange nicht mehr geübt habe et cetera. Das ist ja erstmal ein Modus des Konjunktivs. „Man müsste mal“, „man hätte mal“, „ich hätte ja eigentlich“, und jetzt komme ich mal dazu, jetzt ist endlich mal die Zeit. Mir kommt es so vor, dass es darum geht, aus diesem Modus des Konjunktivs in den Modus des Indikativs einzusteigen.
HARTMUT ROSA: Genau.
JONAS zipf: Also die Dinge zu tun und nicht nur als Möglichkeitsraum sich vorzustellen. Jetzt möchte ich eine zentrale Herausforderung benennen für das, was du beschreibst mit der Resonanzerfahrung oder auch mit der Frage, wann wir unverfügbar sind, wie wir uns in Dinge vertiefen wollen und wirklich in Resonanz rein kommen. Wie müssen wir uns konzentrieren? Wir müssen uns auch entscheiden gegen andere Dinge. Wir müssen sagen, ich lerne jetzt Klavier, und das ziehe ich über die nächsten Jahre durch. Also gewissermaßen ein Moment der Artistik, des ständigen Übens, um eine Tiefe in die Sache rein zu bekommen und dadurch der Qualität. Das bedeutet aber, mich gegen die vielen anderen Möglichkeiten zu entscheiden, die uns allen heute jederzeit vermeintlich ständig zur Verfügung stehen. René Pollesch, der Regisseur, hat das mal mit dem wunderbaren Wort Interpassivität beschrieben. Eigentlich reden wir alle über Interaktivität, Social Media, und so weiter, aber er redet von Interpassivität: einer Festplatte voller Filme und einem Social-Media-Account voller Freunde. Ich kann in meinem Leben alles werden, anything goes, aber ich mache eigentlich nichts mehr davon wirklich. Von allem rede ich im Konjunktiv – „das müsste ich mal“, „das könnte ich mal“, „das sollte ich mal“. Die Entscheidung zu treffen, ist aber ein sehr, sehr schmerzlicher Vorgang, denn dann muss ich ja alle anderen Möglichkeiten abschneiden und komme sozusagen in eine starke Bredouille. Das ist eine ganz schön heftig Herausforderung an das Individuum.
HARTMUT ROSA: Ja.
(Im Hintergrund, schon seit einer Weile: Kindergeschrei bei dem einen, Telefonklingeln bei dem anderen!)
JONAS zipf: Oh, ich werde unterbrochen, Hartmut.
HARTMUT ROSA: Ja. Okay. Ehrlich gesagt: Ich auch.
JONAS zipf: Ich muss dich gleich noch mal anrufen.
HARTMUT ROSA: Ja, alles klar. Bis gleich.
Teil 2
(Mittlerweile sind mehrere Stunden vergangen; der Tag neigt sich dem Abend zu. Die Kinder sind im Bett; die Telefonate wurden geführt.)
JONAS zipf: Vorhin sind wir unterbrochen worden. Das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen sinnbildlich. Genau an der Stelle, an der wir über Verfügbarkeit geredet haben, aber eben auch den von mir ins Spiel gebrachten Begriff der Interpassivität. Und justament da sind wir beide von unserer Realität eingeholt worden, ich von meiner familiären im Homeoffice, das, was man euphemistischerweise Homeoffice nennt, und du von deinen Interviewverpflichtungen.
HARTMUT ROSA: Wobei ich festgestellt habe, dass ich nicht schuld war, dass ich das vorher nicht auf dem Schirm hatte. Aber egal, so läuft es halt in etwas chaotischen Zeiten.
JONAS zipf: Die brauchen es dann trotzdem ganz ganz dringend, nicht wahr?
HARTMUT ROSA: Jaja, genau. Aber naja, wir müssen jetzt halt jetzt, glaube ich, alle improvisieren.
JONAS zipf: Ja, aber es ist in Bezug auf deinen Begriff der Verfügbarkeit schon auch interessant. Rückkehren in das Innerste und uns Besinnen – angeblich oder scheinbar -, und dann findet die Kommunikation über die gläsernen Kanäle von WhatsApp, Skype, Zoom und Co. statt….
HARTMUT ROSA: Ja, wir versuchen, die Verfügbarkeit halt sofort wieder herzustellen. Und ich meine, physisch sind wir natürlich jetzt füreinander unverfügbar sozusagen, aber wir versuchen natürlich, mit allen Tricks das zu machen, was die Moderne gekennzeichnet hat: Dinge wieder verfügbar zu machen. So machen wir jetzt Bild und Ton und Sendungen und Veranstaltungen digital verfügbar.
JONAS zipf: … wir waren vorher bei der Rolle der Wissenschaft.
HARTMUT ROSA: Ja.
JONAS zipf: Da sind ein paar Fragen aufgetaucht, die mich zur Rolle von Kunst und Kultur führen. Genau das passiert ja: Die Kolleg*innen sind nicht mehr verfügbar. Sie können das, was ihre ureigene Leidenschaft ausmacht, nicht praktizieren, zelebrieren, auf Bühnen stehen. Und sie glauben offensichtlich, sie müssen jetzt live senden, durchgehend, so dass man schon das Gefühl hat, man kommt in die Bredouille. Achtung, jetzt, um 19.00 Uhr ist der dran, um 19:30 Uhr der, um 20:00 Uhr der. Das ist wie eine kleine Panikreaktion. Als müsse man die eigene Bedeutung, die eigene Relevanz, unter Beweis stellen. Aber auch, jetzt mal positiver gewendet, was tun für sein Publikum. Aber wäre das nicht eigentlich eine viel bessere Phase, um sich komplett zurückzuziehen?
HARTMUT ROSA: Ich denke schon. In gewisser Weise würde ich mir das fast wünschen, weil ich finde, was wir wirklich sehen, das ist, in welchem hohen Maße wir eigentlich in einem Panik- und in einem Fluchtmodus sind. Eigentlich fällt es uns schwer, es mit uns selber auszuhalten. Aus zwei Gründen. Der eine: Wir haben irgendwie immer Sorge, dass wir abgehängt werden, dass da draußen das Netz weiterläuft und die Räder sozusagen weiter in Bewegung sind, bloß wir sind abgehängt. So rennen wir, um uns irgendwie über YouTube oder sonstwo weiter präsent zu halten. Der andere: Wir haben immer Sorge, dass, wenn wir auf uns selber gestellt sind, dass wir dann nicht in Resonanz treten können mit uns, mit der Musik, mit dem Buch, das wir vielleicht zur Hand nehmen, oder mit der Natur, in der wir uns bewegen. Ich glaube, wir haben Angst davor, dass wir dann die Erfahrung machen, die Natur schweigt, das Klavier sagt mir nichts, das Buch ist gar nicht interessant. Aus Angst davor fliehen wir dann sofort zu Netflix oder bestellen uns bei Amazon noch ein Buch. Ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen, dass wir dieses andere In-der-Welt-Sein – ich beschreibe das inzwischen gerne mit dem Begriff der Mediopassivität: also halb aktiv, halb passiv hören und antworten, ohne dass wir eine bestimmte Agenda verfolgen, vielleicht gründlich verlernt haben. Es stellt sich nicht von heute auf morgen wieder ein, bloß weil wir theoretisch mal Zeiträume hätten. Und so fliehen wir und stellen sie uns gleich wieder zu.
JONAS zipf: Genau. Das ist ja ganz nahe beieinander. Der Begriff ist ja ganz nah bei dem was René Pollesch, Interpassivität nennt. Da waren wir ja vorher an einem Punkt, an dem ich gefragt habe, inwiefern es darauf ankommt, Entscheidungen zu treffen und sich dann auf eine Sache zu konzentrieren, sie zuzulassen, auch die Anstrengung, die damit verbunden ist … ich habe das Wort der Artistik bemüht, ungerne von Sloterdijk entlehnt. Aber man kennt das ja vom Sport: nur wenn ich den Berg hochsteige und wirklich über den inneren Schweinehund und die toten Punkte hinweg komme, gelange ich zu diesem Gefühl der Naturresonanz und so weiter. Aber dafür muss ich dann tatsächlich sagen, ich mache jetzt das, und nur das, und ich muss auch bis zumindest an die Grenze rangehen. Und das setzt eine Entscheidung voraus. In der interpassiven Situation muss ich mich nie entscheiden. Da kann ich alles haben, es ist alles verfügbar, um mit deinem Begriff zu operieren, aber nichts mache ich wirklich. Ich mache eigentlich alles nur halb.
HARTMUT ROSA: Ja, ich glaube, dieses Verhalten kann man wirklich bei uns beobachten. Beispielsweise Netflix bietet einem ja immer diese Möglichkeit, alles relativ im Unverbindlichen zu halten, mal da rein zu zappen, mal da noch was zu gucken, mal dort, aber es gibt nichts sozusagen, auf das man sich völlig einlässt. Ich glaube, das hängt wirklich auch damit zusammen, dass wir eigentlich immer dabei sind, uns Potenz anzuhäufen oder Optionen. Wir sind immer damit beschäftigt, noch was zu erwerben, noch was zu bauen, noch was zu planen, von dem wir dann hoffen, dass es in der Zukunft irgendwann unser Resonanzraum wird. Leute sagen: wenn ich mal diese Wohnung habe…, oder wenn ich die Wohnung renoviert habe…, oder wenn ich die neue Küche habe…. Dann stellen sie fest, sie haben die neue Küche und sie haben sich ein Klavier gekauft, aber sie haben immer noch keine Zeit dafür. Wir schieben das immer auf in der Hoffnung, dass irgendwann das Angehäufte – damit meine ich nicht nur Geld, sondern die Bücher, die Videos, die Kanäle, die Fotos, was immer das sein mag – zu einem Resonanzraum wird. Jetzt könnten wir ausprobieren, ob das wirklich diese Qualität erfüllt. Und dann laufen wir, glaube ich, in Panik davon, weil wir Angst haben: Nein, vielleicht nicht. Ja, das kann man vielleicht als Passivität bezeichnen. Mit medio-passiv bezeichne ich aber einen gegenteiligen Zustand, den man zum Beispiel feststellt, wenn Menschen auf gelingende Weise tanzen, richtig intensiv tanzen oder auch, wenn Menschen miteinander Musik machen oder Theater spielen. Wenn man nicht mehr sagen kann, ob man jetzt eigentlich der aktiv Bestimmende oder der Empfangende ist, man ist beides zugleich. Man ist so in ein Geschehen vertieft, dass das Berührt-Werden von etwas Anderem und Das-Darauf-Antworten praktisch zu einem Akt, zu einer Tätigkeit wird, die halb aktiv und halb passiv ist. Und diese Form von Weltbeziehung, ist ganz selten geworden. Und wir sollten, wir können die Räume, die jetzt entstehen, nutzen, um so was wieder zu entdecken. Aber dafür braucht man Geduld. Dann darf man nicht sofort wieder in die Medial-Welten flüchten und ins Internet und in Social Media.
JONAS zipf: Okay. Also das ist dann wirklich der maximale Gegensatz zu Interpassivität, also der Verfügbarkeit aller Optionen, die ich alle nicht wahrnehme. Das, was du beschreibst, wird ja manchmal auch als Flow beschrieben. In dem Schauspielunterricht, den ich im Regie-Studium hatte, gab es Gruppen-Körperübungen, bei denen am Ende nicht mehr klar war, von wem welcher Impuls gekommen ist. Die Tänzer arbeiten zum Beispiel an der sog. Kontakt-Improvisation: Plötzlich bewegt sich so eine Gruppe von Körpern wie ein Körper und man weiß gar nicht mehr, wo beginne ich, wo hört der andere auf, und so weiter.
HARTMUT ROSA: Ja. Genau das meine ich.
JONAS zipf: Aber es ist tatsächlich eine Form des Sich-Einlassens, die voraussetzt, dass ich ganz viel anderes ausblende in diesem Moment. Also ich muss sozusagen die Wahrnehmung darauf hin fokussieren.
HARTMUT ROSA: Ja. Was noch dazu kommt, ist das, was ich Unverfügbarkeit nenne, weil die Entscheidung alleine natürlich nicht reicht. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Also ich stimme dir völlig zu. Wir sind zum Beispiel ganz wild auf Spotify oder Streaming-Dienste, weil wir dann neun Millionen Musiktitel haben. Da ist eine Wahnsinnspotenz. Aber es reicht jetzt dummerweise nicht, zu sagen, so, heute nehme ich das da oder so. Weil ich dann möglicherweise feststelle: Ah, irgendwie ist es doch nicht das Richtige, das hält nicht, was es versprochen hat. Man kann dann dieses, das, was ich Resonanz nenne, dieses intensive In-Beziehung-Treten nicht erzwingen. Das kommt nicht von alleine. Das braucht einerseits Geduld und Übung, andererseits aber auch eine gewisse Gelassenheit, weil es eben unerzwingbar ist. Und deshalb fällt uns das sehr häufig sehr schwer.
JONAS zipf: Jetzt kommen wir noch mal zu dem Ausgangspunkt zurück. Da bin ich ja mit Celan eingestiegen und habe gesagt, da sind so viele Hoffnungen und Ängste.
HARTMUT ROSA: Ja.
JONAS zipf: Und wenn du jetzt davon sprichst, wir projizieren das, all die Resonanz-Ressourcen, Momente, die wir uns eigentlich erarbeiten unser Leben lang, immer in die Zukunft, dann gibt es ja eine Schallmauer, auf die wir unweigerlich immer zulaufen und das ist die Ressource Zeit, die uns zwar vermehrt wurde, medizinischerweise. Ich kann aber nicht immer weiter in die Zukunft projizieren. Irgendwann ist sozusagen der Moment der Eigentlichkeit gekommen oder eben verstrichen. So. Im Moment erlebe ich die Krise aber auch so, dass wir sehr, sehr viel hinein projizieren. Wir sind noch nicht mal drei Wochen in diesem Shut-down, in diesem kompletten Abschalten, aber die Menge der Denkansätze, der Utopien, Dystopien, der Ängste, der Hoffnungen, sind schon so viele, dass sie gar nicht mehr zu erfüllen sind in einer gewissen Zeit. Es ist eigentlich sozusagen eine riesige Projektionsfläche, die vor allem was darüber aussagt, wie Vieles vor der Krise im Unbewussten ungeklärt war, oder es auch weiterhin bleibt. Oder?
HARTMUT ROSA: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, dass die Krise im Moment so eine Art Brennglas-Funktion hat. Alle Probleme, auch alle Ängste, alle Reaktionsweisen, die die Gesellschaft schon gekennzeichnet haben, die kommen jetzt in einigen Hinsichten sogar in Reinform zum Ausdruck. Zum Beispiel auch das Misstrauen gegenüber Fremden, das wird jetzt geradezu körperlich spürbar in der Angst, der Fremde könnte, der Andere könnte infiziert sein. Und auch das Verhältnis, die Art, wie wir versuchen, auf Unverfügbares zu reagieren, nämlich fast panisch. Insofern stimme ich dir ganz zu, die Krise dient uns als eine Art von Vergrößerungsglas, um uns auch selber und die gesellschaftliche Reaktionsweise zu studieren. Aber zugleich glaube ich, dass es ein Experimentierraum ist. Wir können damit jetzt auch experimentieren und gucken, was machen diese Ängste mit uns, was können wir mit den Ängsten machen, wie können wir da vielleicht zusammen handeln oder auch neue Pfade betreten. Ich habe ja immer diese Fantasie, dass die Krise uns zu so was wie einem gesellschaftlichen Pfadwechsel bringen, also zu einem kollektiven Ausstieg aus den Hamsterrädern führen kann. Aber dazu müssen wir tatsächlich dieses Berasen insbesondere der digitalen Welt irgendwie überwinden.
JONAS zipf: Ja. Also ich würde jetzt gern an der Stelle einen Text einbauen. Nick Cave hat eine Woche lang E-Mails und Briefe bekommen von seinen Fans, warum er jetzt nicht auch endlich mal anfängt, Konzerte zu streamen, und er hat darauf zurückgeschrieben: „Ihr habt es nicht verstanden. Das dachte ich am Anfang auch. Ich komme jetzt endlich zu diesen Dingen, die ich immer machen wollte und die kann ich jetzt umsetzen. Und dann bin ich nachts aufgewacht und mir war klar, das ist genau das, was wir jetzt nicht tun sollten, was ich nicht tun sollte als Künstler. Das ist die größte Chance, die ich habe, auszusteigen aus der alten Logik und erst mal innezuhalten und zu überlegen, was von dem will ich behalten und was will ich nicht behalten danach.“ Das ist ein ganz starker Text.
(siehe: https://www.theredhandfiles.com/corona-fill-the-time/)
HARTMUT ROSA: Ich finde das auch. Da hat er so was von Recht. Aber es ist wahnsinnig schwer, das zu tun. Ich stelle das auch bei mir fest. Ich dachte das auch. Das war zwei, drei Tage auch so. Und jetzt stelle ich irgendwie fest, überall, die Verlage, die Unis, die Web-Seiten, die Medien, fangen an zu sagen: Ah, wie können wir denn jetzt digitale Angebote schaffen, digitale Konferenzen halten. Als hätten wir nichts Besseres zu tun, als so schnell wie möglich die Hamsterräder wieder aufzubauen und digital laufen zu lassen. Und ich stimme Nick Cave total zu. Wir sollten es kollektiv nutzen und mal einen Moment innehalten. Das kann wirklich dieser Gesellschaft und uns auch als Individuen nicht schaden.
JONAS zipf: Ja. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, sollten wir eher aus dem Gespräch aussteigen, weil wir sonst das Gleiche machen.
HARTMUT ROSA: Ja, das ist irgendwie so. Aber wenn ich noch einen Gedanken hinzufügen darf. Es ist einfach nicht richtig, dass es am Ende nur die ökonomischen Zwänge sind, die uns ins Hamsterrad treiben. Die sind es natürlich zum Teil auch, aber man stellt wirklich fest, dass irgendwie auch in uns selbst eine Tendenz da ist und die ist eine Art von kultureller und sozialer Logik, die nicht einfach auf das Ökonomische reduziert werden kann. Dass jetzt jeder denkt, wir müssen jetzt was anbieten, wir müssen irgendwie präsent sein und was tun: Das ist nicht einfach durch einen ökonomischen Zwang zu erklären. Das ist auch in uns.
JONAS zipf: Ja, ich glaube, die Bemerkung ist noch sehr wichtig. Wir haben diese Logik der Steigerung, der Intensivierung, oder überhaupt der Intensität sehr stark verinnerlicht, sehr stark internalisiert. Das ist nicht nur ein ökonomischer Zwang. Das ist, glaube ich, entscheidend, das ist ein psychologisches Moment.
HARTMUT ROSA: So ist das. Und dann fliehen wir.
JONAS zipf: Ja. Mich hat das sehr nachdenklich gemacht. Deswegen will ich jetzt tatsächlich sozusagen aus dem zweiten Teil dieses imaginären Osterspaziergangs aussteigen. Weil ich damit genau das Gleiche gemacht habe, auch mit dir als Gesprächspartner, was wir jetzt gerade raus gearbeitet und beschrieben haben.
HARTMUT ROSA: Ich finde das auch irgendwie. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, muss ich gestehen.
JONAS zipf: Und ich bin jetzt einfach Kulturmensch und Theatermensch, wie du weißt. Ich habe noch einen Text, mit dem ich dich quasi am Schluss noch mal nerven muss. Das ist asynchron, weil ich die Texte vorlese und du sie ja gar nicht vor dir siehst, sondern nur hören kannst. Aber ich habe noch einen gefunden, der mich sehr beeindruckt hat, vor ein paar Tagen. Auch das ist vielleicht das Zwischenstadium des Aussteigens, dass man so alte Texte hochkommen sieht. Hier ist ein Fragment von Heiner Müller, ein Szenenfragment, das mal gedacht war für den Abschluss von Germania 3, einem seiner letzten Stücke.
Das Fragment trägt den Titel: KRIEG DER VIREN. Und das geht so (rezitiert Heiner Müller):
(Leeres Theater. Autor und Regisseur, betrunken.)
AUTOR Ich habe ein Gedicht geschrieben.
REGISSEUR (hält sich die Ohren zu) Sags auf.
AUTOR Tödlich der Menschheit ihre zu rasche Vermehrung
Jede Geburt ein Tod zu wenig Mord ein Geschenk
Jeder Taifun / Erdbeben eine Hoffnung / Hoffnung der Welt Lob den Vulkanen
Nicht Jesus Herodes kannte die Wege der Welt
Die Massaker sind Investitionen in die Zukunft
Gott ist kein Mann keine Frau ist ein Virus
Du hörst mir nicht zu.
REGISSEUR Stimmt. Warum sollte ich. Wir sind im Theater.
HARTMUT ROSA: Das ist in vielerlei Hinsicht wirklich aufschlussreich. Es wirft die Frage nach der Rolle des Theaters auf, aber es beantwortet sie irgendwie auch. Dass nämlich das Theater ein Raum ist, in dem man Perspektiven einfach mal radikal wechseln und verändern und sich fragen kann, wie sieht es denn aus einer ganz anderen Perspektive aus. Zum Beispiel, wenn man so was, so schwer das ist, irgendwie, in dem Fall würde ich sagen, so was wie ein kosmische Perspektive einnimmt: Ist es für die Natur eigentlich schlimm, wenn Menschen reduziert werden oder verschwinden? Das ist eine schon immer interessant gewesene Frage, über die wir vielleicht sogar auch noch mal nachdenken könnten. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur und sogar von Mensch und Virus ist, glaube ich, viel komplexer, als wir uns das auf den ersten Blick denken.
JONAS zipf: Ja, also wir sind ja in der Theater-Diskussion an einem Punkt, wo man viel vom Theater des Anthropozäns spricht und tatsächlich die Natur schon in den klassischen Theatertexten in der Antike als großes Gegengewicht zur Gesellschaft beschreibt. Tatsächlich ist dieses Fragment aber interessant in Bezug auf die Rolle von Kunst generell. Wo Müller, der Regisseur natürlich, sagt, ich höre dir nicht zu, warum sollte ich, wir sind im Theater. Einerseits ist es natürlich die maximalste Irrelevanz, vor der Kulturschaffende heute immer mehr Angst haben, weil sie damit komplett außerhalb von Welt stattfinden, also keine Nachhaltigkeit mehr haben. Andererseits ist es dieses Unverfügbarsein, das sie brauchen. Vielleicht sind die zwei, um die es da geht, so alleine auf der Bühne, und das ist das Beste, was ihnen passieren kann, es ist eben keiner dabei, der das sofort bewertet und verwertet. Sondern die sind einfach nur zu zweit. Und das ist einfach vielleicht stärker.
HARTMUT ROSA: In der Soziologie wird auch viel über die Figur des Dritten nachgedacht oder auch über die Notwendigkeit, dass es da noch einen gibt, der sozusagen dann beide, also den Hörenden und den Nicht-Hörenden sieht oder hört und dazu dann auch Stellung nimmt. Das ist schon auch ein interessanter Fall. Aber ich glaube, bei der Frage „Werden wir gehört?“ oder „Wer will das Theater eigentlich noch hören?“, denke ich öfters darüber nach, habe sogar überlegt, ob ich noch mal einen Text schreibe. Ich glaube halt, man muss auch … eigentlich muss man was zu sagen haben und überzeugt sein davon, dass es sich lohnt, das zu hören, damit andere interessiert sind und auch zuhören wollen. Ich kann nur erwarten, dass jemand zuhört, wenn ich überzeugt bin, dass ich etwas zu sagen habe. Ich glaube, dass in der Kunst oder auch in der Wissenschaft das Problem sein kann, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Künstler und Künstlerinnen verlernt haben oder nicht bereit sind, sich als ganze Person hörbar und sehbar zu machen und einzubringen.
JONAS zipf: Das ist eine Frage von Haltung und Stellung-Beziehen, also auch in einem sehr paradoxen Sinne. Also ich muss quasi erst mal sagen, es ist mir ganz egal, was die anderen dazu sagen oder ob ich damit Erfolg habe oder nicht, oder was bewirke oder nicht. Und nur, wenn es mir egal ist, werde ich etwas bewirken können. Das ist paradox. Dieses Sich-von-der-Welt-Abwenden, um dann danach wieder etwas wirksam hinterlassen zu können, ist eine Bewegung, die ich im Theater für mich selber nicht hinbekommen habe, warum ich sozusagen letztlich dann in die Verwaltung bzw. Politik gegangen bin. Aber ich glaube, da gibt es eine strukturelle Analogie zur Wissenschaft, die ganz ähnlich ist. Man kann sich natürlich verdingen in Drittmittel-relevanten Denkweisen und so weiter. Oder man kann sich zurückziehen. Es ist eine Kunst, diese Balance hinzubekommen. Und es ist besonders da eine Kunst, wo man eben keine empirischen Grundlagen hat, wie in den Naturwissenschaften.
HARTMUT ROSA: Naja, wenn man einfach Daten erhebt, dann kann man sozusagen natürlich die Daten für sich sprechen lassen. Da kann man sagen, ich als Forscher spiele gar keine Rolle, hier ist mein Befund. Das ist eine andere Art von Wissenschaft als die, die wir in den Kulturwissenschaften oder auch in der Sozialtheorie und -philosophie betreiben, in denen es keine unabhängigen Daten gibt, sondern nur Deutungen. Was ich glaube, was wir tun können, ist, einen Vorschlag zu machen, wie wir unsere Welt und unsere Lage deuten können. Und da verschwimmt dann sozusagen auch tatsächlich der Horizont zwischen dem, was wir als Wissenschaftler*innen und dem, was wir als Privatpersonen sagen. Und letzten Endes auch die Grenze zwischen Wissenschaftler, Künstler und Publikum. Weil wir sozusagen alle an einer adäquaten Deutung, jetzt gerade der Corona-Krise, arbeiten.
JONAS zipf: Ja. Genau. Aber, und das ist dann der Punkt, an dem wir die Kurve für den Kreis des Gesprächs noch mal kriegen. Es kommt natürlich darauf an, dass man sich zurückzieht. Diese Balance ist vielleicht ein bisschen flöten gegangen. Das heißt, dass uns eigentlich dieser Unterbau fehlt. Ich habe mal einen Spitzenpolitiker gefragt, ob er eigentlich als Politiker, wenn er Entscheidungen trifft, noch wirklich zum Nachdenken kommt. Und er sagte: „Ich zehre eigentlich nur von all dem, was ich gedacht, diskutiert, besprochen, habe, bevor ich in diese Position gekommen bin. Seitdem ich da bin, bin ich eigentlich nur noch am Reagieren. Es gibt keinen Moment mehr, in dem ich sozusagen noch so was ausbaue wie eine Gedankenressource. Ich kann nur von dem Vorrat leben, den ich mir davor angehäuft habe.“
HARTMUT ROSA: Das hat mein Doktorvater genau, fast identisch, zu mir gesagt. Herfried Münkler hat, als ich promoviert habe, gesagt: „Lies und denk so viel wie du kannst, weil du später ein ganzes Wissenschaftsleben davon bestreiten und davon zehren musst.“ Und eigentlich ist das eine Katastrophe, dass wir es soweit haben kommen lassen.
JONAS zipf: Ja. Genau. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, ein tieferer Punkt, den wir jetzt berühren, der dieses Fass, das da jetzt durch Corona aufgemacht wird, oder die Büchse der Pandora, so tief und so groß werden lässt. Also an dem ich sage: Da kommt jetzt viel hoch, was irgendwie kollektiv verdrängt ist.
HARTMUT ROSA: Ja, denke ich auch.
JONAS zipf: Das kann man durchdeklinieren auf viele Ebenen, und in vielen Biografien, vielen Formen der Arbeit und des Lebens.
HARTMUT ROSA: Ja.
JONAS zipf: Ach, das ist schon wieder so ein bisschen so ein trauriger Punkt. Ich sage trotzdem noch mal, dass ich ganz entscheidend finde, dass du einen heftigen Einwand gebracht hast im ersten Teil des Gesprächs, als ich zu so einer kulturpessimistischen Tirade angehoben habe und du sagtest: Geschichte ist etwas, was wir machen, in diesem Moment. Und wenn dieser Moment jetzt ein Moment des Einfrierens ist, dann ist das ein offener Moment. Und darauf kommt es an, du gebrauchst ja auch den Begriff des Experiments, dass wir die Sache als Chance verstehen!
HARTMUT ROSA: Ich finde das auch sozusagen die richtige Schlussnote. Es gilt allgemein, dass Menschen immer Geschichte machen. Aber in aller Regel haben sie da ganz wenige Spielräume, weil Gesellschaften sich pfadabhängig vorwärts bewegen. Eine kapitalistische Maschinerie, die läuft einfach. Und da richtest du als Individuum ganz wenig aus. Aber wenn das Ding in die Krise gerät, wenn die Routinen auf breiter Front irritiert werden, dann haben Akteure ein viel höheres Gewicht und eine größere Relevanz. Und da werden Handlungsoptionen wirklich offen. Da entsteht Kreativität. Und ich glaube, wir haben so einen Punkt erreicht. Kann man vielleicht Bifurkationspunkt nennen, wenn man in der Theorie der Pfadabhängigkeit redet. Also einer, an dem eine neue Abzweigung entstehen kann, und diese sollten wir jetzt gemeinsam finden, dann wird alles gut.
JONAS zipf: Ja. Und vorher vielleicht noch einen Moment stehen bleiben, und die Offenheit dieser Stelle zwischen den Pfaden vielleicht auch genießen oder zumindest zulassen.
HARTMUT ROSA: Ja, das stimmt.
JONAS zipf: Okay. Lieber Hartmut. Vielen, lieben Dank.
HARTMUT ROSA: Sehr gerne.
JONAS zipf: Das war ein Osterspaziergang mit vielen Aspekten, wo man fast an jeder, um mal bei dem Bild zu bleiben, Abzweigung, noch viel weiter hätte gehen können. Aber das wundert mich bei dem Tempo des Denkens und Sprechens nicht.
HARTMUT ROSA: Ja, aber dein Hinweis auf das Innehalten ist, glaube ich, echt wichtig. Und vielleicht sollten wir jetzt wirklich einfach auch innehalten und über die Abzweigungen noch mal nachdenken.
JONAS zipf: Punkt.
[1] Siehe Wikipedia: Hannah Arendt führte 1958 den Begriff „Natalität“ in ihre Theorie des Handelns ein. In ihrem philosophischen Hauptwerk Vita activa oder Vom tätigen Leben (engl. The Human Condition) fragte sie nach den Bedingungen menschlicher Existenz. Sie nannte diesbezüglich „das Leben selbst und die Erde, Natalität und Mortalität, Weltlichkeit und Pluralität“. Natalität als Grundbedingung der menschlichen Existenz zu verstehen, basierte auf ihrer Beobachtung, dass „dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d. h. zu handeln“. Ihr Ansatz fand Eingang in bioethische Debatten.
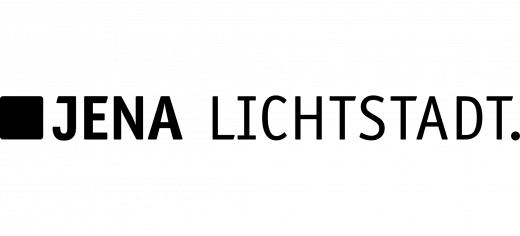

Ein anregendes Gespräch da draußen vor dem Tor! Vielleicht als Gegenpart, bestimmt als kritische Ergänzung zu diesen Betrachtungen empfehle ich die Überlegungen zur Corona-Krise von Klaus Dörre:
https://jacobin.de/artikel/klaus-dorre-corona-krise-chance/
Danke für den ausführlichen Osterspaziergang. Sehr erbaulich in nachdenklichen Zeiten, und Innehalten bedeutet ja nicht Stillstand!
Wir sollten Alle hoffen und dafür streiten , dass sich möglichst viele in Demut üben und die Chancen, wie im Beitrag so treffend beschrieben auch so wahrnehmen und vor allen auch umsetzen. Noch mal Danke und schöne Ostertage Thomas Eckardt