Über Plattformkapitalismus und Inklusion
Es ist das zehnte Gespräch* (*zwei sind noch nicht hier erschienen, Anm. d. R.), das der Kulturverantwortliche der Stadt Jena Jonas Zipf führt, seit die Pandemie vor mittlerweile mehr als einem Jahr unser Leben fundamental zu verändern begann. Es ist Zeit darüber zu sprechen, wie wir aus der Krise herauskommen, nicht nur gesellschaftlich und kulturell, sondern auch materiell und wirtschaftlich. Wer wird zu den tiefen Verlierern gehören, wer wird profitieren? Wer geht als Gewinner aus der Katastrophe hervor und wer zahlt die Rechnungen? Spätestens ab dem zweiten der bisherigen Gespräche bemühte sich Jonas Zipf um den Literatur- und Kulturwissenschaftler Joseph Vogl als Gesprächspartner zu diesen und anderen Fragen. Es gehört zur zeitlichen Struktur und Ironie der Pandemie, dass es ausgerechnet und endlich zum Kontakt kommt, als längst die ersten Debatten zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte laufen, nicht zuletzt auch in Jena. An einem Samstagabend, mitten in der Faschingszeit, treffen sich der Professor und der Werkleiter – nicht, um eine Clubhouse-Party zu feiern, sondern um zu telefonieren. Sie sprechen über V-Effekte und das Inklusionsversprechen der Tech-Giganten, über Wetten und Werte, Informationen und Meinungen, die unhinterfragte Sozialisierung von Risiken sowie den rauschhaften Genuss des Profits.
JONAS ZIPF: Hallo Herr Vogl?
JOSEPH VOGL: Guten Tag Herr Zipf!
JONAS ZIPF: Schön, dass es klappt. Dass es endlich klappt, muss ich fast schon sagen. Hinter Ihnen bin ich ja schon eine ganze Weile her.
JOSEPH VOGL: Sie waren hartnäckig.
JONAS ZIPF: Das stimmt. Als ich mit dieser Gesprächsreihe im ersten Lockdown letztes Frühjahr begann, da gab es von Anfang an Begegnungen mit Menschen, die ich nur über ihr Wirken, ihr Schaffen kannte, also mit Personen, die ich bis heute persönlich noch gar nicht kennen lernen konnte. Gemessen daran, dass jetzt alle Welt den eigenen Rücken vor irgendwelchen Laptop-Bildschirmen ruiniert, waren diese Telefon-Gespräche regelrechte Blind Dates. Immer hatten wir einen gedanklichen Ausgangspunkt und haben davon ausgehend geschaut, wo uns das hinführt. Und ab dem zweiten Gespräch habe ich dabei an Sie gedacht. Ich kannte Sie als Autor von „Das Gespenst des Kapitals“, und das erschien mir sofort als eines der zentralen Themen in dieser ganzen Corona-Krise: Ich meine damit nicht nur die Ökonomie an und für sich, sondern eben die Frage, wie über Ökonomie gesprochen wird, bzw. welches Vokabular verwendet wird und welche dahinter liegende Psychologie sich durch dieses Vokabular offenbart. Daher möchte ich auch mit Sprache beginnen. Ich habe hier einen kleinen Auszug aus einem musikalischen Lexikon, den unsere Musiker der Jenaer Philharmonie im Bachhaus Eisenach entdeckt haben. Es ist der Eintrag zum Stichwort Corona. Ich zitiere: „Corona oder Coronata wird von den Italienern ein Zeichen genennet, welches, wenn es über gewissen Noten in allen Stimmen zugleich vorkommt, ein allgemeines Stillschweigen oder eine pausam generalem bedeutet. Wenn es aber über einer Finalnote und einer Stimme allein steht, so zeiget es an, dass die da selbst so lange aushalten soll bis die übrigen Stimmen auch zu ihrem natürlichen Schluss nachkommen, um den Ort zu bemerken, wo alle Stimmen innehalten können, wenn geschlossen werden soll.“ Diese musikalische Notenbezeichnung beschreibt für mich eine Hoffnung, wie ich sie aus dem letzten Frühjahr kenne. Eine Hoffnung darauf, dass einfach alles einschläft und der Sturm vorüberziehen möge. Dass wir anschließend aufwachen und alles ist wie vorher. Von der Ausbildung her bin ich ein Theatermann. Wenn von V-Effekten die Rede ist, dann zucke ich zusammen und denke an Bertolt Brecht und seinen Verfremdungs-Effekt, anstatt an einen volkswirtschaftlichen Effekt. In der aktuellen Situation erleben wir viele Institute und Ökonomen, die darauf spekulieren, dass die Wirtschaft, sobald alle Menschen geimpft sind, wieder in Schwung kommt wie zuvor. Es wird manchmal so getan, auch in der Fiskalpolitik, als würde man gerade im Moment eine Pausetaste drücken und danach in den alten Zustand zurückkommen können, also V einmal runter, einmal hoch. Für mich hat dieses V vor allem eine andere Konnotation, nämlich Vertrauen, und ich erinnere mich dann unwillkürlich zurück an die Finanzkrise ab 2007 und an die damaligen Aussage von Kanzlerin und Finanzminister: „Ihre Sparguthaben sind sicher!“ Offensichtlich hatte diese Aussage eine enorme Vertrauensbildung. Eine der allerersten Aussagen, zu Beginn von Corona, die mir noch ähnlich präsent ist, stammt vom bayrischen Ministerpräsidenten und lautete: „Whatever it takes“. Es scheint, als wäre der Staat mit seinen Unterstützungsleistungen eine Art Bürge für volkswirtschaftliches Fortkommen Es läuft eine immense Wette auf die Zukunft, und von ähnlichen Wetten kann man doch historisch viel lernen. Und deswegen wundere ich mich. An vielen Stellen in den Corona-Gesprächen bemühen wir die Metapher „Corona als Brennglas“, „Corona als Brandbeschleuniger“, „Corona als Katalysator“ und beziehen uns auf Probleme, die schon vorher da waren. Aber im ökonomischen Sektor, wenn wir jetzt über die finanziellen Auswirkungen auf öffentliche Haushalte sprechen, da tun wir momentan so, als könnten wir eine Pausetaste drücken. Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Wie geht es ihnen, wenn sie vom V-Effekt hören?
JOSEPH VOGL: Ich bin sehr vorsichtig, was Prognosen angeht. Und ich würde sagen, es lohnt sich hinzusehen, was im Augenblick passiert, also bereits flackert und sichtbar ist. Der erste Punkt bezeichnet eine sehr überraschende Angelegenheit: All die Prinzipien, die man noch zur Finanz- und Eurokrise aufgestellt und dann noch zusätzlich verschärft hat – Schuldenbremsen oder die schwarze Null, etc. –, haben auch dazu geführt, dass in verschiedenen sogenannten Südländern u.a. Gesundheitssysteme geschoren und eingespart wurden. Das waren und sind keine technischen, keine ökonomischen Erfordernisse, sondern schlichtweg politische Prinzipien, die da aufgestellt und auch gegen bestimmte Länder wie Portugal, Spanien und Griechenland durchgesetzt wurden. Das ist eine erste wichtige Lehre aus der gegenwärtigen Situation. Also, das heißt: Geldpolitik ist tatsächlich Politik im strengen Sinne und keine technokratische Größe. Als zweiten Punkt kann man, glaube ich, angesichts einer weltweiten Pandemie, angesichts weltweit steigender Todeszahlen, angesichts einer zusammenbrechenden Ökonomie auch festhalten, dass die Aktienkurse gestiegen sind, und zwar auf ein Allzeithoch. Eine bestimmte Form der Ökonomie kann sich also tatsächlich von der Restwelt abkoppeln. Das ist in letzter Konsequenz natürlich die Finanzökonomie, die über überschüssiges Geld sich nicht zu beklagen hat. Und die, nebenbei gesagt, ja auch von der gegenwärtigen Situation nur indirekt betroffen sein könnte, an den Stellen, an denen möglicherweise vielleicht Geschäftspartner bei ausfallenden Krediten in Schwierigkeiten geraten könnten. Dritter wichtiger Punkt, den man in ökonomischer Hinsicht festhalten kann: Die Gewinner stehen längst fest. Die Gewinner mit astronomischen Profiten sind die Internetfirmen, die Internetplattformen. Da ist bereits eine neue ökonomische Realität geschaffen worden. Die wird bis auf weiteres bestehen bleiben, auch mit anwachsenden politischen und regierungstechnischen Einflüssen. Ich spreche von Unternehmen wie Google oder Amazon oder Facebook, die sich nun durch eine Ausweitung von Kontrollmacht und eine Aneignung von Infrastrukturen auszeichnen.
JONAS ZIPF: Daraus ergeben sich für mich zwei Aspekte. Zum einen die extreme Verschärfung der Unterschiede zwischen Arm und Reich, sowohl im wirtschaftlichen Sektor, was Unternehmen anbelangt, Gewinner und Verlierer, als auch im privaten Bereich. Da wären neben den Kennziffern wie Einkommen oder Verschuldung auch sonstige Folgeeffekte zu nennen, etwa in Bezug auf Bildung, Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche. Zum anderen finde ich, dass diese Entwicklungen rhetorisch ummantelt werden. Sie sprachen ja davon, dass es um politische Entscheidungen geht. Gerade in der Finanzpolitik gehen jetzt ganz plötzlich Dinge, die jahrelang nicht gingen und bei denen jahrelang der Zungenschlag einer ausweichlosen Sachpolitik und Alternativlosigkeit vorherrschte. Die Rhetorik, das Wording, das Vokabular in diesem Politikbereich ist ja geprägt von einer Mathematisierung, in der immer eins plus eins gleich zwei ist. Nur so kenne ich Haushaltsdebatten, insbesondere rund um uns Kulturschaffende, Debatten, die schon jetzt in neuem Ausmaß losgehen. Dabei sind es am Ende einfach politische Prioritäten. Das heißt ja doch, dass sich da eine gewisse Rhetorik entlarvt: Rückwirkend, wenn wir dann darauf schauen – ich habe ja vorher schon einmal die Analogie zu der Finanzkrise ab 2007 gezogen – dass Systeme nicht verändert wurden, also dass man aus diesen Krisen eben keine Ableitungen getroffen hat und Dinge in nachhaltigere Bahnen gelenkt hat. Das ist erschreckend und zeigt, dass hier im Grunde ständig Wetten auf die Zukunft gemacht werden. Darin liegt, wie mir scheint, ein grundlegender Mechanismus nicht nur der Finanzwirtschaft. Sie haben es gerade beschrieben – es ist ja nichts anderes als eine virtualisierte Wirtschaft, die Amazon, Google und Co. da treiben und vom realwirtschaftlichen Sektor, also sprich von wirklich greifbaren Produktionsvorgängen, komplett abgekoppelt haben. Und die Politik hält dem auch noch einen Steigbügel hin und verkleidet das Ganze nach außen hin nach wie vor mit einer Rhetorik, die immer sachpolitisch und alternativlos daherkommt.
JOSEPH VOGL: Also zwei Dinge. Zum ersten: Es ist jetzt nicht verwunderlich, sondern es ist überaus konsequent, dass man die letzte Krise, also sowohl die Finanzkrise wie die Eurokrise zur Befestigung des bestehenden Systems genutzt hat. Es wäre sehr naiv zu glauben, man hätte die gute Gelegenheit verstreichen lassen. Das heißt also, die Doppelkrise 2007/2008 und 2010/2011 wurde genutzt, das bestehende Finanzsystem zu stärken, und es wurde gezeigt, dass im Zweifelsfall Bevölkerungen als Mindestreserven für Gläubiger zur Verfügung stehen. Das ist eine sehr konsequente Politik gewesen, über deren Effekte und Parameter man sich nicht wundern muss.
Ein zweiter Punkt: Finanzindustrie, Finanzökonomie und Plattform-Unternehmen haben sich nicht irgendwie von der Realwirtschaft losgelöst. Es ist dramatischer. Diese Industrien wirken ganz entscheidend in die Realwirtschaft hinein und diktieren die Bedingungen, die Bedingungen für Renditen, die Bedingungen für die Produktion, die Bedingungen für Arbeitskosten und Beschäftigungsverhältnisse, etc. Es wurden ganz neue Maßstäbe für die Prozesse der Wertschöpfung gesetzt.
JONAS ZIPF: Da hat sich dann wahrscheinlich auch in den letzten 10 Jahren extrem viel noch einmal zurückverschoben. Die Frage, die sich mir sofort stellt: Ist das zu komplex, um es zu durchschauen? Eine Mehrheit der Menschen profitiert davon ja nicht, auch nicht in den westlichen und nördlichen Gesellschaften, über den globalen Maßstab gar nicht zu sprechen. Eine Mehrheit profitiert davon nicht und müsste doch eigentlich damit nicht einverstanden sein. Das kann doch nicht alleine daran liegen, wie ich es vorher formuliert habe, dass die beschriebenen Vorgänge und Strukturen immer noch rhetorisch ummantelt werden. Deshalb: Liegt es daran, dass es zu komplex ist? Das was Sie im „Gespenst des Kapitals“ schreiben, von einem schwarzen Schwan, von der Tulpensituation in Holland, das sind ja schon relativ komplex zu durchschauende Vorgänge. Und die liegen Jahrhunderte zurück. Mittlerweile ist es ja offensichtlich noch wesentlich komplexer geworden. Das, wovon Sie da sprechen, erinnert mich an den lateinischen Wortstamm der Worte Kredit und Kredibilität. Credo heißt ja direkt übersetzt „ich glaube“. Anscheinend geht es nicht mehr um Mathematik und Rationalität, sondern um Glauben und Vertrauen. Die Wirtschaft hat sich quasi vom Sparen, vom Vermögen der Vergangenheit, zur Wette auf das spekulative Vermögen der Zukunft verlagert. Liegt es daran, dass sich nicht massive gesellschaftliche Gegenbewegungen formieren?
JOSEPH VOGL: Zunächst, glaube ich, in Bezug auf die Funktionsweise dieser jüngsten Form, wenn Sie sich tatsächlich auf den Plattformkapitalismus, auf die Plattformindustrie beziehen, ließen sich wahrscheinlich drei Aspekte hervorheben. Der erste Aspekt ist tatsächlich der, da haben Sie völlig recht, dass sogenannte Lohnabhängige nicht von diesen Unternehmen profitieren, da es denen gelingt, Arbeitsplätze radikal zu externalisieren. Man kann ohne Chauffeure taxis fahren lassen, ohne Personal kann man Wohnungen und Ferienwohnungen vermieten etc. Das ist das Prinzip der Plattformunternehmen: dass sie minimale Marginalkosten haben, minimale Transaktionskosten, minimale Personalkosten, minimale Fixkosten und damit verbundene Verpflichtungen. Das heißt also: Ein Arbeitsmarkt profitiert nicht direkt von diesem Unternehmen. Im Gegenteil gerät das Verhältnis von Gewinnen und Marktwerten einerseits und Beschäftigungszahlen andererseits in ein geradezu perverses Verhältnis gegenüber der konventionellen, wenn man so will: produzierenden, Industrie. Zweiter Punkt aber ist, dass die Unternehmen ja mit niedrigschwelligen Angeboten ein hohes Maß an Inklusion produzieren. Die Verführung dieser Unternehmen besteht darin, dass man kostenlose Dienste, kostenlose Textchen, Bildchen und Filmchen, kostenlose Suchergebnisse, kostenlose Apps etc. bekommt und damit, wie man sagt, Netzwerkeffekte erzeugt. Solche Gratifikationen werden mit der Aussicht auf soziale oder professionelle Nachteile verknüpft, die bei einem Ausstieg aus den Plattform-Communities drohen könnten. Und dritter Punkt, der dazu gehört, der eben auch den Erfolg und damit auch den, wenn man so will, fehlenden Widerstand, erzeugt: Diese Unternehmen konkurrieren nicht mehr selbst auf den Märkten, sondern sind als Plattformenunternehmen tatsächlich Eigner von Infrastrukturen, die andere miteinander konkurrieren lassen. Man konkurriert nicht gegen Facebook, man konkurriert nicht gegen Amazon, sondern man konkurriert auf der Plattform von Amazon oder Facebook oder weiß Gott was gegeneinander. Das sind die drei Punkte, die – glaube ich – zeigen, dass es wenig realistisch wäre, einen manifesten Widerstand quer durch Bevölkerungen zu erwarten.
JONAS ZIPF: Auch hier zeigt sich wieder eine gewisse Komplexität. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja konkrete Alltagserfahrung. Entweder stimme ich den „Terms and Conditions“ zu oder ich kann die jeweilige App eben nicht nutzen. Wenn ich irgendwo einen einfachen Vorgang im digitalen Raum pragmatisch lösen will und mich nicht damit in der Tiefe beschäftigen kann, vermeintlich, oder will, was Datenschutz anbelangt, dann habe ich quasi auf das Geschäftsmodell eingezahlt. Ich finde das zutreffend umschrieben, dass das eigentlich einen Inklusionsmomentum der Plattformökonomie bedeutet. Um das zu durchschauen benötigt es aber schon eine einigermaßen komplexe Analyse. Es ist viel leichter, beispielsweise die Fleischwirtschaft zu skandalisieren. Als die ganze Tönnies-Diskussion los ging, habe ich zum einen gedacht, das war vorher auch schon alles bekannt, zum anderen, dass Amazon & Co sich jetzt freuen können, denn die Tarifdiskussionen in Bad Hersfeld gerieten so ins Hintertreffen der öffentlichen Wahrnehmung.
Ich möchte da ein bisschen tiefer hineingehen. Ein anderes Buch von Ihnen lautet „Kalkül und Leidenschaft“. Über das Kalkül haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen: Von Kalkül, sowohl auf ökonomischer, als auch auf politischer Seite; vom strategischen Nutzen ummantelnder Rhetorik. Worin besteht aber die Leidenschaft, die dahinter steckt? Wir reden ja schließlich am Ende über Menschen, die Entscheidungen treffen. Die Leidenschaft, einfach immer noch mehr Geld zu horten, das sowieso die Nachfahren in zehn Generationen nicht ausgeben werden können, kann es alleine ja nicht sein. Wir reden sonst gern über die Krise als Chance für alles Mögliche. Aber sie haben die Chancen jetzt wirklich auf den Punkt gebracht: Hier werden Chancen genutzt, bestehende Systeme zu festigen, die eigentlich spätestens seit 2007 viel kritischer untersucht und verändert hätten werden müssen. Worin besteht aber über dieses Kalkül hinaus die Leidenschaft von denen, die das betreiben?
JOSEPH VOGL: Man muss eine Sache noch hinzufügen zu dem, was wir gerade besprochen haben. Sie haben das Beispiel der Fleischindustrie gebracht. Der Fall ist tatsächlich ein anderer. Es war klar, man wusste, dass es nicht immer mit rechten Dingen zugeht, was insbesondere Subunternehmer betrifft, was Arbeitsbedingungen betrifft usw. Diese Sache ist ruchbar geworden, jetzt in einem speziellen Fall. Und was hier wirksam wird, ist die Sichtbarkeit rechtlicher Schranken, die bereits existierten, oder zweifelhafter Geschäftspraktiken, die man nun überprüft. In der Plattformindustrie – und das ist die radikale Differenz – haben wir es mit klar definierten rechtlichen Ausnahmen zu tun, mit Haftungsprivilegien. Solche Unternehmen sind für eingestellte Inhalte nicht verantwortlich. Seit den 1990er Jahren hat man erstens die öffentlichen Netzwerke privatisiert und zweitens etwas geschaffen, was man Internet-Exzeptionalismus nennen muss. Sei es Facebook und die Verfolgung der Rohingya in Myanmar oder die Live-Übertragung von Massenmorden im Netz – die Netzbetreiber können allenfalls nachträglich zum Löschen von Inhalten überredet werden. Und was die Rolle von Affekten betrifft: Man sollte sie nicht einfach als psychische Angelegenheiten begreifen, sondern als Systemformationen. Affekte zirkulieren, sie sind Treibsätze für bestimmte soziale, ökonomische Systeme. So hatte Karl Marx etwa die „abstrakte Genusssucht“ verstanden: einen Bereicherungstrieb, der sich nicht mit einer episodischen Befriedigung hier oder dort stillen lässt und parallel zur Kapitalakkumulation als grenzenloses Verlangen funktioniert. Und seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man einen neuen Sozialaffekt beobachtet: das Ressentiment. Kierkegaard hat das als „negativ-einendes Prinzip“, als „negative Einheit der negativen Gegenseitigkeit der Individuen“ gefasst – und dies lässt sich mit dem Wettbewerbslärm von Marktgesellschaften ebenso kombinieren wie mit den sozialen Schismen, die auf den heutigen Meinungsmärkten vertrieben werden. Das Ressentiment wäre die Moral der Gewinnler und Profitler, ein entsolidarisierender Affekt, der die Maschinerie aber in Betrieb hält.
JONAS ZIPF: Ich muss jetzt unwillkürlich an den amerikanischen Präsidenten denken, der diese Woche aus dem Amt geschieden ist. Beide Affekte kann man ihm wahrscheinlich zuschreiben. Ich kopple das jetzt noch einmal rück mit der Frage der Verantwortlichkeit von Facebook, Twitter und Co. für die Inhalte und die Auswirkungen der Inhalte, die über ihre Plattformen laufen. Wir hatten ja zuletzt die Diskussion, warum Twitter es auf die letzten Meter der Präsidentschaft von Donald Trump geschafft hat, dann endlich den Account abzustellen. Diese beiden Affekte, die Sie beschrieben haben, schienen mir bis dahin zuzutreffen auf diese Person und haben so massiv ins Politische zurückgewirkt. Der erste bestand ganz offensichtlich in einer Verlängerung des Genusses, von dem sie gesprochen haben, über den rein monetären oder wirtschaftlichen Rahmen von Macht hinaus, bis ins Politische hinein. Der zynische und exhibitionistisch zur Schau gestellte Genuss, Multimilliardär zu sein und auch noch amerikanischer Präsident werden zu können. Der zweite Affekt, den sie beschrieben haben, das Ressentiment, zeigt sich darin, aus dieser Position heraus dann auch noch die Puppen tanzen zu lassen und Andere gegeneinander auszuspielen, während und sogar über die Amtszeit hinaus. Beide Affekte, scheinen mir, treffen auf ihn idealtypisch zu. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach der Perspektive, wie wir diese Mechanismen entlarven und auch in die politische Willensbildung zurückbringen. Das scheint mir zentral. Da bin ich etwas verzweifelt, vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß es nicht. Aber wir müssen doch widersprechen, und zwar in einem offenen politischen Raum. Das, was Sie beschreiben, ist doch schlagend, und es scheint kaum stattzufinden in einer Mainstream-Debatte.
JOSEPH VOGL: Nein, da gebe ich Ihnen Recht, und dafür wird es auch keinerlei freundliche Perspektive geben. Allerdings sind die Dinge ja bekannt. Das betrifft einerseits die Erzeugung von Partikulargesellschaften, die Erzeugung von Partikularitäten, die Erzeugung, wenn man so will, von sozialen und kognitiven Monaden – das Geschäftsmodell der so genannten sozialen Medien. Andererseits die Allgemeinheit dessen, was man ‚Infopinion‘ nennen könnte, diese Mischung aus Information und Meinung, die zum Grundwasser öffentlicher Verständigung geworden ist.
JONAS ZIPF: Mir scheint, dass dieser Mechanismus der Informations- oder Geschäftspolitik der Social Media vielleicht in abstrahierter Form übereinzubringen ist mit dem Wirtschaftsmechanismus, der dahinter steckt. Information und Meinungen sind eins geworden. Auf einer abstrakten Ebene könnte man also sagen, dass dieses Geschäftsmodell darauf basiert, dass Information und Meinung nicht mehr zu trennen sind. Dann ist Geld irgendwann nicht länger nur Informationsträger, sondern auch Meinungsträger. Ich meine und vertraue darauf, dass ein bestimmter Aktienkurs steigen wird, mache quasi diese Wette. Das alles funktioniert über Vertrauen, über Kredibilität, über Blasen letztlich, ohne das ich weiß, ob es wirklich belastbar sein wird. Am Ende, wenn es schief geht, badet es die Allgemeinheit aus, das haben Sie auch vorher erwähnt. Aber wenn es klappt, dann streichen die Gewinne einzelne Wenige ein. Und das sind doch enorme Risiken, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir in einer Risikogesellschaft leben. Ich muss oft an dieses Paradigma von Ulrich Beck denken. Gerade in dieser Corona-Phase, in der die Beträge immer größer werden, Beträge, die nur noch von großen Staaten kollektiv ausgebadet werden können, von der ganzen Allgemeinheit oder sogar internationalen Zusammenhängen. Das hat sich wirklich ins Unermessliche gesteigert. An diesem Punkt möchte ich noch einmal auf einen Affekt kommen, auch Teil einer Psychologie, und zwar einer negativen. Die zwei Affekte, die sie genannt haben, sind ja Treiber, Triebfedern, für die einzelnen Akteure. Für die Allgemeinheit, für den Staat, der das ausbaden muss, momentan gleichsam im vorauseilenden Gehorsam in die Schulden geht, gibt es aus meiner Sicht auch einen Affekt, vielleicht so etwas wie ein kollektiver Affekt, der mit dem eingangs erwähnten ersehnten V-Effekt viel zu tun hat. Sie kennen ja sicher Daniel Kahneman, den Wirtschaftspsychologen, der so trefflich herausgearbeitet hat, dass der Aktienmarkt oft funktioniert wie am Roulette-Tisch: Wenn ich an einer Stelle verliere, dann setze ich den doppelten Betrag auf genau die Zahl, mit der ich verloren habe, um meine Verluste wieder auszugleichen. Diese Psychologie hat sich möglicherweise rückübertragen auf ganze Staaten oder Staatenverbünde. Wir setzen als Staat auf dasselbe Wirtschaftssystem, weil wir darauf hoffen – jetzt komme ich auf den V-Effekt zurück – dass wir aus der Krise heraus wieder Wachstum generieren, damit wir alle öffentlichen Funktionen am Laufen halten. Wir setzen immerzu auf denselben Mechanismus, setzen immer mehr vom selben aufs Spiel. Das ist genau der Affekt, den Kahneman beschreibt. Dabei ist es vollkommen irrational, auch aus politischer Sicht, in der aktuellen Situation nicht über Alternativen nachzudenken, sondern im vollen Wissen, dass das alte System nicht fair und gerecht ist, dieselben Mechanismen mit öffentlichem Geld immer weiter zu verstärken.
JOSEPH VOGL: Ich befürchte, dass diese Psychologie nicht hinhaut. Psychologie erklärt nichts. Allenfalls müsste man die Psychologie selbst als erklärungsbedürftig ansehen. In einem Punkt gebe ich Ihnen aber Recht. Seit den siebziger Jahren herrscht auf den Finanzmärkten ein Informationsstandard: Information über Geld ist wichtiger geworden als Geld selbst. So werden etwa Preise für Finanzprodukte aller Art als komprimierte Meinungen über mögliche Marktchancen, über Wertentwicklungen begriffen, somit als Informationen darüber, welche Gewinnerwartungen man mit bestimmten Assets verknüpft. Unter diesen Bedingungen können Kapitalmärkte als signalverarbeitende Systeme installiert werden, als ein Finanzautomat, in dem Informationen Preise, Preise Kaufentscheidungen und diese wiederum Informationen, Preise und Entscheidungen generieren. Finanzmärkte wären demnach prototypische Meinungsmärkte, wie das bereits ein Börsentheoretiker des 17. Jahrhunderts formulierte: An den Börsen sind die Erwartungen von Tatsachen wichtiger als die Tatsachen selbst. Ähnlich bei John Maynard Keynes: Börsenmärkte funktionieren wie Schönheitswettbewerbe, wo es eben darum geht, die Meinungen anderer und die Meinungen über Meinungen vorwegzunehmen. Umgekehrt arbeiten die Algorithmen der Informations- und Meinungsmärkte – auf Suchmaschinen, Plattformen – wiederum nach ökonomischen Bewertungslogiken, Datenbroker also hier wie dort. Bei dem anderen Punkt aber, was die Psychologie betrifft, muss man die Sache schlichtweg umdrehen. Die Leute verhalten sich nicht irrational, sondern sie verhalten sich durch und durch rational, auch wenn das zuweilen irrationale Effekte produziert. Finanzmärkte funktionieren eben anders als Glücksspiele oder Pferderennen: Auf solchen Märkten kann man, wie Schumpeter einmal sagte, Pferde durch Pferdewetten voranbringen.
JONAS ZIPF: Kahnemann hat ja auch nicht die gesamten Systeme einer Börse und eines Kasinos miteinander verglichen, sondern nur den isolierten psychologischen Mechanismus des Verlierens und des Gewinnens. Irrational wird es, da würde ich jetzt nochmal einhaken, möglicherweise, sobald die Berechnung, dass der Verlust, also wenn es schief geht, von der Allgemeinheit noch getragen werden kann, irgendwann nicht mehr aufgeht. Also wenn ich entweder die Zitrone nicht weiter ausquetschen kann, weil ich keine weiteren Externalisierungseffekte hinbekomme, also sprich trotz Ummantelung einer Inklusion, die Sie vorher trefflich beschrieben haben, einfach nicht mehr aus der Volkswirtschaft an Geld herausbekomme, oder wenn politische Mehrheiten vielleicht dann doch irgendwann kippen. Ein Punkt, den ich noch nicht aufgebe. Dann wird es irrational, weil die Rechnung dann nicht mehr aufgeht. Wenn die Beträge immer höher werden – das ist ja das, was Kahneman so schön herausarbeitet – dann wird der Verlust ja auch immer größer, nicht nur der Gewinn. Dann kann ich vielleicht die Beträge der Finanzkrise ab 2007 noch auffangen mit immer neuen Wetten auf die Zukunft. Ich spreche ja jetzt immerhin von öffentlichen Haushalten – natürlich gehen Staaten nicht pleite, aber sie können zahlungsunfähig werden, es können enorme Probleme entstehen. Sie haben darüber gesprochen, welche Einschnitte die südeuropäischen Staaten in der Konsequenz der Fiskalpolitik der europäischen Institutionen erleiden mussten. An einem solchen Punkt verbinden sich die beiden Punkte, dass die Verluste volkswirtschaftlich einfach nicht mehr ausgeglichen werden können mit einem zwangsläufigen politischen Veränderungsprozess. Syriza kam, als die sozialen Systeme zusammenbrachen, Sparguthaben geschröpft wurden, Altersheime nicht mehr bedient wurden etc. – Sie haben das Beispiel ja vorhin angeführt. Also von daher wird die beschriebene Dynamik auch im Sinne der von Ihnen jetzt attestierten rationalen Stützung des Reichtums und der Gewinner irgendwann irrational, weil ich einfach den Bogen überziehen kann mit dieser Logik des immer größeren Gewinns.
JOSEPH VOGL: Vor langer Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Sorge groß, auf welche Weise man einen entfesselten Kapitalismus samt seiner Katastrophen – wie in den 20er Jahren – einhegen könnte. Deswegen hat man sich für eine gebremste Variante mit sozialstaatlichen Strukturen, auch in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien, eingesetzt. In den 70er Jahren, spätestens Anfang der 80er, musste man feststellen, dass dieses System wesentlich mehr Elend verträgt, als man dachte, und dass es profitabel ist, mehr Elend zu erzeugen, dass es profitabel ist, Einkommen von Lohnabhängigen zu Kapitalvermögen umzuverteilen. Auch im Augenblick ist dieser Prozess an kein Ende gelangt. Sie haben zwar völlig recht: Jede dieser letzten Krisen, in denen das Finanzsystem sozusagen anrüchig wurde, jede dieser Krisen ist eine Akkumulationskrise gewesen. Zu viel Geld war im Umlauf und suchte nach neuen Investitionsmöglichkeiten, vor allem auf Kapital- und Immobilienmärkten. Aber spätestens nach den Crashs von 2000 und 2008 und mit der Aufzucht der Internetkonzerne ist eine besondere ökonomische Brache erschlossen worden, die Ressource der Information. Wer immer im Netz herumspaziert, produziert Datenrohstoff und arbeitet an der Extraktion von Mehrwert durch die Plattformunternehmen, ob er will oder nicht. Mit der Bewirtschaftung von Information hat der Kapitalismus eine jüngste Metamorphose durchgemacht, und am Horizont steht schon der nächste Schritt: dass man neben allen möglichen Infrastrukturen auch noch das Währungssystem ganz und gar privatisieren könnte.
JONAS ZIPF: Wir stehen vermutlich genau an dieser Schwelle: Bitcoin wurde jetzt vor kurzem als Zahlungsmittel bei PayPal zugelassen, etc.
JOSEPH VOGL: Das sind die profitabelsten Unternehmen, diese Zahlungsdienstleister. Deren Geschäfte mögen technisch kompliziert sein, betriebswirtschaftlich aber sind sie simpel. Man kassiert schlicht bei jeder Transaktion. Ein parasitäres System. Und der neueste Schrei ist eben das Währungsprojekt von Facebook, „Diem“ genannt – eine atemberaubende Vision: Man verwandelt knappe drei Milliarden User in Kontoinhaber und die Datenraffinerie selbst in eine Investmentgesellschaft. Vor dem Hintergrund solcher Experimente sollte man wohl zwei Dinge in Rechnung stellen. Erstens: dieser Kapitalismus wird nicht an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Und zweitens: So wenig er mit einem Mal erschaffen wurde, so wenig lässt er sich irgendwie und mit einem Streich abschaffen. Er ist kein homogenes System, sondern ein Gefüge, das überall leckt, ächzt, Tümpel bildet, Schwachstellen und Widerstände produziert. Somit kann man, wenn man nur will, hier und dort Hebel ansetzen, um Ströme umzuleiten und Funktionsweisen zu ändern, das Spektrum reicht von der Steuerpolitik bis zur Regulierung der Informationsindustrie.
JONAS ZIPF: Damit gehen Sie einerseits über Marx hinaus. Indem Sie sagen, der Kapitalismus wird nicht an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen. Und andererseits gehen Sie vor ihn zurück, weil das, was Sie jetzt zuletzt angedeutet haben, das sind ja Denkweisen, die vor Marx stark waren. Doch mir scheint, hier kommen wir zurück auf den von Ihnen herausgearbeiteten Kernpunkt der neuen, von Marx eben nicht ahnbaren, inklusiven Qualität der Plattformökonomie, die den Kapitalismus letztlich in einer neuen Dimension stabilisieren hilft. Das merken wir Kultur-Leute in der Corona-Zeit mehr denn je. Es ist dies ja eine Zeit des Streamens und der Social Media, des Bestellens von Produkten über das Netz. Die realen physischen Hochpräsenz-Angebote und -Begegnungen kommen möglicherweise nicht so v-mäßig wieder, wie es jetzt so oft beschworen wird. Ob das jetzt die Innenstädte sind mit dem letzten verbliebenen inhabergeführten Einzelhandel, der gerade den Bach runter geht, oder wir als Kulturakteure, die ganz große Zukunftsängste haben müssen, weil wir nicht wissen, ob die Nutzer von Netflix und Co. zu uns zurück ins Konzerthaus und Museum kommen. Mittlerweile fasse ich mich da ein bisschen an die eigene Nase, denn ich selbst war vielleicht immer sehr optimistisch, auch bei diesen Corona-Gesprächen, die ich führe. Habe immer mehr über Krise als Chance gesprochen. „Inne Halten“ war die Überschrift über dem ersten Buch. Als wäre diese Krise ein Moment, in den man eintaucht und mal kurz zu sich kommt und reflektiert, was man danach wirklich verändern könnte. Das war vielleicht auch so ein bisschen das Momentum, die Stimmung im März und im April des letzten Jahres, zumindest vielleicht in intellektuellen Kreisen. Aber jetzt merken wir, dass andere nicht geschlafen haben und aus der Krise ihre Lehren ziehen und extrem profitieren. Jetzt färbt sich der Horizont schon wesentlich dystopischer ein. Und deswegen komme ich in die Schlusskurve und möchte Sie einfach fragen: Worin besteht Hoffnung? Was ist unser Ansatzpunkt, wenn wir jetzt gleich aus dem Gespräch aussteigen, an dem wir weiterarbeiten können, Sie als Wissenschaftler, ich als Kulturschaffender, um vielleicht Alternativen denken und auch andere davon überzeugen zu können?
JOSEPH VOGL: Ich glaube, die Situation vom Frühjahr letzten Jahres war eine andere als heute. Damals hatte man sich auf eine Pause eingestellt, Atem geholt, vielleicht sogar die Entschleunigung des Alltagsbetriebs ein wenig gemocht. Der Ausnahmezustand hat auch ein eigenes Zeitgefühl mit sich gebracht – ein wenig durchhalten, dann ist es vorbei. Diese Situation hat sich definitiv geändert. Die Krise ist jetzt in einem Jahr stationär geworden, eine weltweite Katastrophe, keine Krise mehr. Da verändert sich auch die Zeitwahrnehmung, und das könnte an einem Punkt durchaus Erfreuliches mit sich bringen, trotz aller Düsternis. Mir scheint, man sehnt nun nicht mehr so innig die alte Normalität zurück, sondern womöglich eine veränderte Welt, vielleicht sogar mir neuen Gewohnheiten, mit sozialen, ökonomischen und politischen Konsequenzen aus den vergangenen Monaten. Und der zweite Punkt: bei allen Debatten über pandemische Gefahren und Maßnahmen, samt spitzer Polemiken oder Bösartigkeiten, hat sich doch eine Art Gravitationszentrum herausgestellt, nämlich ein Kampf um die Fragen von Gemeinwohl und Gemeingüter, wie immer man sie auch definieren mag, medizinisch, ökonomisch oder sonst wie. Das zumindest wäre ein erfreuliches Resultat dieser letzten zwölf Monate.
JONAS ZIPF: Das Stichwort wäre also eine neue Realität, in Abweichung von dem, was Olaf Scholz am Anfang neue Normalität genannt hat. Da ist eine gewisse Sehnsucht entstanden an vielen Stellen, das ist klar. Aber das ist natürlich ein sehr diffuser Moment, und wenn wir nochmal auf diesen Generalpausen-Charakter zurückgehen, im besten Fall eine später formbare, eben erst mal offene Situation. Die lebt aber natürlich davon, dass sich Alle darauf einlassen. Und wenn nun Einige die Stränge weiter in der Hand halten und weiter vorantreiben, ist die Chance doch sofort vertan. Im Moment – tatsächlich halte ich Krise nicht mehr für das richtige Wort, da gebe ich Ihnen recht – öffnen sie noch einmal die Augen und sehen die Katastrophe. Vielleicht ist das auch sehr zuständlich in der Wahrnehmung des einen oder der anderen, vielleicht sind wir wirklich in den inneren Räumen in unseren privaten Wohnungen, im Homeoffice, vor Zoom in einem krummen Zustand, auch körperlich, angekommen. Ja, mit dem Hinweis auf das Gemeinwohl – wir könnten jetzt auch von Allmende oder Commons sprechen – sagen sie etwas, was, glaube ich, Vielen bewusster geworden ist. Aber die Frage ist doch, ob wir das gestaltbar bekommen. Das wird ein weiter Weg.
Herr Vogl. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war ein lautes Nachdenken, wobei ich von Einsichten gelernt habe, die Sie mitgebracht haben. Und am Ende sind wir jetzt vielleicht ein wenig in das Offene hinausgetreten…
JOSEPH VOGL: …und wünschen uns dort: Gute Gesundheit.
Machen Sie es gut.
JONAS ZIPF: Sie auch*

Liebe Leser:innen unseres Blogs. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein schönes Osterfest. Vor genau einem Jahr haben wir an dieser Stelle das erste Corona-Gespräch veröffentlicht, mit Hartmut Rosa. Damals dachten wir noch, dass die Pandemie bis spätestens Herbst überstanden sei. Unterdessen wissen wir, dass uns das Virus weiter begleiten wird. Gleichwohl hoffen wir sehr, dass das Impfen und der Sommer wieder einiges ermöglichen werden. Bleiben Sie unbedingt gesund und uns treu!
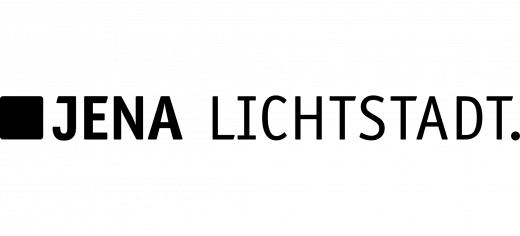

Gut aufgepasst….. , schon die zehnte Ausgabe!
Ich empfinde es genau andersherum – wenig Lärm um wegweisende Gedanken. Was bräuchte wir in diesen Zeiten mehr. Bedenkenträger haben wir genug . Ich für meinen Teil habe Alle Bloggespräche genossen und kann diese nur weiterempfehlen.
Ostergrüße und gerne eine Fortsetzung Thomas Eckardt
Viel Lärm um nichts – von Jonas Zipf, die zehnte Ausgabe mittlerweile.