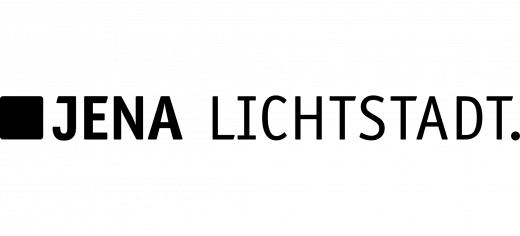Ein Telefonat zwischen Prof. Norbert Frei und Jonas Zipf zur aktuellen politischen Situation
Sie kennen sich aus Jena: Der Historiker Norbert Frei und der Kulturpolitiker Jonas Zipf sind sich zuerst im Kontext von Karl Marx über den Weg gelaufen. Das war 2018. Jonas Zipf plante ein sogenanntes künstlerisch-wissenschaftliches Symposion rund um den 200. Geburtstag von Marx und versammelte unterschiedliche Perspektiven aus Kultur und Wissenschaft. Norbert Frei zeigte sich mit einigen geplanten Beiträgen ganz und gar nicht einverstanden, und so begann ein zunächst kontroverser, aber stets fruchtbarer Dialog zwischen dem Historiker und dem kommunalen Kulturverantwortlichen rund um Erinnerungspolitik und Gedenkkultur. Für ihren Beitrag zur Reihe der Corona-Gespräche des Werkleiters von JenaKultur treffen sich die beiden am Tag nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also am 15. März 2021. Die Eindrücke des Wahlabends sind noch frisch: Im Verlaufe des Telefonats lässt sich Norbert Frei – gänzlich entgegen seiner Profession als Historiker und Chronist abgeschlossener geschichtlicher Situationen – auf eine Spekulation rund um die sehr offene politische Situation mitten in der Pandemie im Superwahljahr 2021 ein…

Foto: Copyright FKH Bad Homburg
Jonas Zipf: Hallo Herr Frei?
Norbert Frei: Hallo Herr Zipf!
Jonas Zipf: Das ist ja schön. Freut mich, dass es klappt.
Norbert Frei: Mich auch.
Jonas Zipf: Wo erwische ich Sie denn?
Norbert Frei: Wir sind im tiefen Oberbayern angekommen, und das im Grunde genommen schon seit einem Jahr. Eigentlich war es immer nur so eine Wochenend-Variante, die wir erst jetzt im letzten Jahr mehr oder weniger zur Dauervariante gemacht haben.
Jonas Zipf: Ich habe jetzt viele persönliche Begegnungen mit Leuten, die sich praktisch durch den Lockdown in Situationen zurückziehen, in denen sie noch weiterarbeiten können. Ich habe gerade vorhin mit meiner Orchesterdirektorin telefoniert, die hier die Geschäfte und Geschicke der Philharmonie führt. Sie macht gerade zusätzlich eine Ausbildung zur Pferdetherapeutin und verbringt ihre ganze Zeit neben der Arbeit auf dem Pferdehof, quasi von Videokonferenz zum Pferdestall und dann wieder zurück. Oder ich denk‘ jetzt spontan an Hartmut Rosa, der die meiste Zeit seit letztem März im Schwarzwald verbringt und nicht mehr hier in Jena vor Ort ist. Also, Herr Frei, wir führen eines dieser Gespräche, die mir im Moment helfen, diese ganze Zeit überhaupt zu überstehen, weil ich dadurch mal zu einem gedanklichen Austausch zu den Dingen komme, die gerade um uns herum passieren. Ich bin froh, dass Sie zu einem solchen Gespräch bereit sind. Wir begeben uns daher praktisch in ein offenes Terrain, gedanklich, gemeinsam, das soll so sein.
Norbert Frei: Einverstanden.
Jonas Zipf: Seit ich im letzten Jahr diese Gespräche begonnen habe, hat sich einiges verändert: Wir sind längst in einem Modus, in dem abgerechnet und aufgerechnet wird mit Dingen, die schieflaufen; eine Situation, in der sich verschiedene Kräfte und Akteure wappnen, wie sie aus der Krise herauskommen. Auch wird immer absehbarer und sichtbarer, wer profitiert und wer besonders gelitten hat. Darüber will ich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Es geht um das, was sich jetzt in diesem Jahr politisch und gesellschaftlich verschiebt und verändert. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, manchmal hoffnungsvoll, meistens sehr ängstlich. Jetzt haben wir gestern (also am 14. März 2021 – Anm. d. Red.) zwei Wahlen erlebt, und Herr Habeck sitzt in einer Talkshow und spricht von Tiefenströmungen und von Teilen in unserer Gesellschaft, die das System eigentlich lieber kippen sehen wollen, und ich glaube, dass er damit recht hat, auch wenn die Prozente auf den ersten Blick ja eher Stabilität verraten. Es existiert zwar diese These, dass die, die jetzt regieren, in der Krise die einzigen sind, die sichtbar bleiben und deswegen wieder gewählt werden, aber ich glaube, dass an der Beobachtung der Tiefenströmungen von Habeck tatsächlich was dran ist. Wir haben von Kipppunkten geredet, letztes Jahr in den Corona-Gesprächen, immer wieder davon, dass eine große Nervosität um uns herum zu beobachten ist. Da würden Sie mir wahrscheinlich recht geben, oder?
Norbert Frei: Es ist eine große Nervosität in uns, das spüren wir alle, glaube ich. Irgendwie kommt es mir so vor, als hänge unsere Nervosität mit der äußeren Immobilität zusammen, mit der wir jetzt seit langem zwangsweise zu tun haben. Dass dies dann auch zu Diagnosen führt, dass es Unterströmungen gebe, das ist durchaus plausibel. Ich frage mich, ob wir wirklich schon in der Situation sind, in der wir diese Unterströmungen auf einen Punkt bringen können. Ich finde das gestrige Wahlergebnis ziemlich interessant. Denn es ist ja doch erkennbar, dass in beiden Fällen, in Rheinland-Pfalz wie auch in Baden-Württemberg, sehr stark Personen gewählt worden sind (Die Wahl fand am Vorabend des Gesprächs, am 14. März 2021 statt – Anm. d. Red.) Es gab einige demoskopische Belege dafür, dass viele Menschen Dreyer oder Kretschmann gewählt haben, obwohl sie sich eigentlich anderen Parteien zugehörig fühlen. Mit anderen Worten: Das Element der Persönlichkeitswahl spielte eine doch beträchtliche Rolle. Äußerlich also dadurch scheinbar viel Stabilität. Aus meiner Sicht ist das Erfreulichste an diesen beiden Wahlergebnissen ja doch die Tatsache, dass die AfD jetzt wieder einstellig ist, zumindest in diesen beiden Ländern, dass sie also ersichtlich nicht von der Krise profitiert. Ob man das – wie das die AfD jetzt gern tut – mit der Stunde der Exekutive erklären kann und der Tatsache, dass die Opposition durch das exekutive Handeln gewissermaßen in den Hintergrund tritt, da wäre ich noch nicht so sicher. Ich glaube, dass es sehr viel mehr mit dem inneren Zustand der AfD zu tun hat und damit, dass sich in Teilen des rechtsbürgerlichen Lagers, das vorher im Westen AfD gewählt hat, Besinnungseffekte zeigen. Das ist erst mal eine gute Nachricht – auch, weil damit zum ersten Mal der Aufwärtstrend, in dem sich die AfD lange befunden hat, gebrochen ist und weil sich gezeigt hat, dass die Mobilisierungseffekte der Corona-Leugner, QAnon-Anhänger etc. sich nicht zugunsten der AfD ausgewirkt haben.
Die nächste Frage ist, wie sich die Verhältnisse im Sommer und im Herbst in den ostdeutschen Bundesländern, die dann wählen, darstellen werden. Vielleicht kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass an der Diagnose, wonach sich die AfD von einer ostdeutschen Protest- zu einer ostdeutschen Milieupartei entwickelt, doch mehr dran ist, als uns lieb sein kann. Mit anderen Worten: Ich glaube noch nicht, dass, nur weil die AfD im Westen zurückgeht, auch ein Rückgang im Osten wahrscheinlich ist. Auf der anderen Seite ist klar: Bundespolitisch scheint die AfD ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Und das ist in dieser ziemlich großen Verwirrung, die gegenwärtig herrscht, schon mal ein gutes Zeichen.
Jonas Zipf: Da gebe ich Ihnen Recht. Bevor wir aber auf den weiteren Verlauf dieses Jahres kommen und tatsächlich auch auf die Situation in Thüringen schauen, was uns beide ja auch wieder direkt betrifft – Stichwort: „Nach der Staatskrise ist vor der Staatskrise“ –, möchte ich nochmal auf das Wahlergebnis von gestern eingehen. Für mich bleibt ganz stark der Wahlkampf-Slogan von Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg hängen: „Sie kennen mich“. Diesen Gedanken möchte ich mal neben die sicherlich zutreffende Hypothese stellen, dass Wähler:innen in der Krise, in der Pandemie, die handelnde Exekutive stärken, weil die auch bei weitem am sichtbarsten ist, bei nicht eingeübten Wahlkampfformaten im digitalen Raum und dergleichen: Ganz offensichtlich gibt es daneben eine gewisse Sehnsucht in größeren Teilen der Bevölkerung, dass die Dinge stabil bleiben mögen. Das ist doch vielleicht das Muster. Ich spreche ja jetzt in Ihnen mit einem Historiker. In der zumindest bundesrepublikanischen Geschichte gab es fast durchgehend eine strukturelle Mehrheit für eine konservative Wählerschaft, und es gab ähnliche Kampagnen wie die von Kretschmann, beispielsweise unter der Überschrift „Keine Experimente“ von Adenauer. Dieses Muster, da würde ich gerne noch etwas tiefer reingehen, das offenbart – das ist jetzt meine Spekulation – vielleicht den Wunsch Vieler im Land, dass es nach der Krise so sein möge, wie es davor war. Volkswirtschaftlich ist manchmal die Rede vom V-Effekt: Wir müssen jetzt mal runterfahren, alles einfrieren, danach kommt aber alles wieder in Gang, so wie es davor war. Diese Erzählung, dieses Narrativ, fällt mir einfach auf, weil es ja zeitgleich, das ist uns, glaube ich, allen bewusst, große Transformationsthemen gibt. Das sind also zwei Narrative im Vollkontrast: Der Wunsch nach Stabilität einerseits und Corona als Brandbeschleuniger, als Brennglas, als Katalysator, z. B. der Digitalisierung, andererseits. Diese Transformationsthemen würden doch eigentlich eine andere, innovativere politische Energie benötigen. Da entsteht ein echtes Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen: „Keine Experimente“ und „Sie kennen mich“ auf der einen Seite und dem nötigen Veränderungsdruck oder auch -wunsch bestimmter Teile der Gesellschaft auf der anderen Seite. Ich glaube z. B., dass es kein Zufall ist, dass wir uns in einer Phase von ganz ausgeprägtem Aktivismus befinden: Vor der Krise Fridays for Future und andere, in der Krise dann das große identitätspolitische Thema und Bewegungen wie Black Lives Matter. Wir leben in einer Zeit, in der transformatorische Themen sich in vehementer Art und Weise stellen. Letztlich steht doch, ich benutze das Wort jetzt polemisch: das politische Establishment, das sich gestern eine Bestätigung abgeholt hat, in einem Widerspruch zu der gesellschaftlichen Transformation und Veränderung, oder?
Norbert Frei: Als Historiker würde ich einen Punkt besonders unterstreichen, den Sie gerade genannt haben: Dass dieses Bedürfnis nach Stabilität etwas ist, was die Deutschen lange ausgezeichnet hat. Die relativ rasche Stabilisierung der Demokratie als einen Wert an sich zu empfinden, hat das politische Bewusstsein nach 1945 geprägt. „Bonn ist nicht Weimar“ lautet die berühmte Parole, die uns der Schweizer Journalist Fritz René Allemann schon 1956 beschert hat, und die über Jahrzehnte geradezu gebetsmühlenartig wiederholt worden ist – in bestimmten Krisensituationen in beschwörender Weise, dann aber auch wieder stolz und anerkennend. Ja, tatsächlich: Bonn ist nicht Weimar geworden. Und insofern gibt es in der Tat diese Linie von Adenauers „Keine Experimente“ zu Merkels „Sie kennen mich“. Gestern Abend hat Kretschmann auf die Frage, ob er da geklaut habe, lächelnd gesagt: „Ja klar, warum auch nicht? Das ist ja ein guter Slogan!“ Wenn man jetzt aber mal genauer auf die Wahlergebnisse schaut, dann stellt man fest – da komme ich doch nochmal zurück auf die AfD –, dass sie bei den männlichen Wählern der mittleren Generation deutlich am stärksten ist, also bei den 30- bis 60Jährigen, die zum Teil auch weniger gut gebildet sind. Das fiel mir heute Morgen bei der Zeitungslektüre auf: Dass hier die Wertschätzung dieser alten Stabilitätserzählung nicht mehr so verfängt, wie das bei den Älteren offenkundig noch der Fall ist.
Bei den Jüngeren sehen wir – Fridays for Future war Ihr Stichwort –, dass dort die Vorstellung von dem hohen Veränderungsdruck, unter dem wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, stehen, deutlich ausgeprägter ist als bei den Älteren. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Insofern frage ich mich also: Beschleunigt die Krise die Veränderung oder wirkt sie eher retardierend? Ich denke, man muss wirklich genau hinschauen, auf die unterschiedlichen Felder. In manchen Bereichen habe auch ich das Gefühl, wir wären, ich will nicht sagen: stillgestellt, aber in Vielem gehemmt und nicht so schnell vorwärts unterwegs, wie wir uns das vorstellen. Auf der anderen Seite werden die Veränderungsbedürfnisse und -notwendigkeiten – Stichwort Digitalisierung – dramatisch sichtbar. Und auch die Ungeduld wächst an vielen Ecken und Enden. Wir befinden uns jetzt ein Jahr in der Krise, aber die Infrastruktur ist immer noch nicht viel besser geworden. Insgesamt ergibt sich ein sehr gemischtes Bild, wie ich finde. Jedenfalls teilen viele dieses allgemeine, fast schon mit Händen zu greifende Unbehagen über die Ungewissheit unserer Situation; die Angst, von der Sie eingangs gesprochen haben. Es entsteht aus meiner Sicht aber noch kein klares Bild, wo die Auswege liegen könnten. Ich sehe eher Ausflüchte. Zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich heute Morgen, was ich seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, nicht getan habe, mal in die BILD-Zeitung geblickt, weil ich wissen wollte: Wie wird dort wohl die Tatsache verhandelt, dass Mallorca jetzt geöffnet ist? Meine Phantasie war offensichtlich groß genug, denn das, was ich vermutet hatte, war da tatsächlich auf den populistischen Punkt gebracht: „Malle für Alle!“ Es geht also um Fluchtbewegungen, sobald sich ein kleiner Lichtblick mitten in der dritten Welle zu zeigen scheint. Das sind natürlich Reflexe des Zurück in das Althergebrachte. Mein Gefühl ist aber, dass sehr, sehr viele eigentlich wissen: Vieles wird nicht mehr so werden, wie es vorher war.
Jonas Zipf: „Malle ist alle!“ (lacht) Da ist ein großer innerer Druck. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Immobilität ein Treiber dieser Nervosität, dieser mit Händen greifbaren Nervosität und Angst ist. Und in der Tat sind viele der Wünsche nach Lockerungen geprägt davon, dass es wieder so sein möge wie davor. Das mit Mallorca ist dafür fast sinnbildlich, das kann man, glaube ich, sehr gut als Sinnbild verstehen.
Jetzt gehen wir mal in die Thüringer Situation rein. Mein Berufsalltag ist im Moment davon geprägt, dass die Oberbürgermeister in Weimar und in Erfurt vehement – mit großem Druck ihrer innenstädtischen Händler im Hintergrund – fordern, dass Lockerungen und Öffnungen stattfinden. Das hat die Landesregierung dazu gebracht, dass man jetzt dieses sehr unklare Instrument namens Modellversuche in die neue Grundverordnung mit einpreist, eine Grundverordnung, die übrigens noch kaum auf die Stufenlogik von Öffnungen einzahlt, die vorvergangene Woche von den Ministerpräsidenten:innen eigentlich beschlossen wurde. Aber der Inzidenzverlauf in Thüringen lässt auch im Moment einfach nicht mehr zu. Trotzdem gibt es so etwas wie eine Öffnungsklausel in dieser neuen Grundverordnung, die besagt, dass man wissenschaftlich begleitete Modellversuche unternehmen kann. Sprich, man kann eine Innenstadt hernehmen und sagen: Wir testen regelmäßig und etablieren digitale Kontaktnachverfolgung, dann können wir mal für vier oder fünf Tage aufmachen unter bestimmten Auflagen, die das Gesundheitsministerium gestatten muss. Dabei wissen Alle eigentlich bereits, dass das kaum zu realisieren ist: Es sind zu wenige Tests da – selbst wenn sie da sind, bleibt unklar und umstritten, wer sie bezahlt – die digitale Kontaktnachverfolgung ist auch noch nicht da bzw. umstritten, nicht zuletzt bei den Datenschützern. Die Schere und Diskrepanz zwischen den Erwartungshaltungen, die auch ständig, ich will sagen: durch Ankündigungspolitik vorangetrieben werden, und dem, was dann tatsächlich gemacht werden kann, wird immer größer. Dieses Erwartungs-Sandwich ist ein ständiger Begleiter in der Pandemie, den wir von Anfang an erlebt haben: Abends werden Beschlüsse gefasst und verlautbart, am nächsten Morgen stehen die Menschen vor der Tür, also ganz buchstäblich, auch bei uns, bei den Kultureinrichtungen, und erwarten, dass die Dinge sofort umgesetzt sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Art von Ankündigungspolitik gerade ihr Übriges dazu tut, dass sich das System selbst destabilisiert. Das ist ja das, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen: Wir erleben, wie sich in Talkshows in aller Öffentlichkeit Politiker:innen gegenseitig beschuldigen; wie ein einziges Kompetenzgerangel zwischen den föderalistischen Ebenen um sich greift; wie auf fast populistische Art und Weise Kommunikationsinstrumente genutzt werden: wie unser Ministerpräsident Bodo Ramelow nach der Runde der Ministerpräsident:innen, aber noch vor der offiziellen Pressekonferenz der Kanzlerin, meint, vor die Presse treten zu müssen. Also alles sozusagen Manöver und Elemente, die aus meiner Sicht dazu geeignet sind, dieser Nervosität eigentlich begegnen zu wollen, sie aber im Endeffekt dann noch zu verstärken, weil noch mehr Unklarheiten in die ganze Situation kommen.
Norbert Frei: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, den man noch sehr viel grundsätzlicher ansehen kann. Der auch über das hinausgeht, was gewissermaßen als Profilierungssucht und Nervosität im Wahljahr gelten kann. Wir sind an diesem Punkt, wo wir wieder und wieder mit einem Strukturwandel der Öffentlichkeit konfrontiert werden. Das ist ein Thema, das wir jetzt schon seit vielen Jahren erleben, dessen Folgen wir aber noch kaum abschätzen können: Ich spreche von den Folgen der Tatsache, dass nahezu jede Politikerin und jeder Politiker von einiger Bedeutung meint, sich vornehmlich über Twitter äußern zu müssen, und mit diesem ständigen wechselseitigen Überbietungswettbewerb noch zur Krise der klassischen medialen und politischen Öffentlichkeit beiträgt. Dieses Tempo führt dazu, dass angesichts der laufenden dritten Welle gegen jede Erkenntnis, die eigentlich allen zur Verfügung steht, in einer wirklich beängstigenden, geradezu widersinnigen Art und Weise, unsinnige Vorschläge gemacht und unsinnige Regeln beschlossen werden. Das alles ist nur noch so zu verstehen, dass es – abgesehen von der Schreckensphase am Anfang der Pandemie im letzten Spätwinter und Frühjahr – offenbar keine funktionierenden Möglichkeiten mehr gibt, den öffentlichen Diskurs, wie soll ich sagen, in verantwortlichen Bahnen zu halten. Es war nicht von ungefähr, dass ich die BILD-Zeitung ins Gespräch gebracht habe: Wenn Sie sehen, was ich erst kürzlich begriffen habe – nämlich dass die inzwischen mit einem eigenen Fernsehkanal im Internet operieren, und zwar brachial operieren –, dann ist auch leicht erklärlich, dass sich die kurzzeitige Rückgewinnung von Vertrauen in und Aufmerksamkeit für die traditionellen Medien, die wir am Anfang der Pandemie hatten, leider wirklich nur der Ausnahmesituation verdankte. Trotz mancher neuer Anstrengungen der Öffentlich-Rechtlichen scheint der Prozess der Auflösung dessen, was wir früher mal bürgerliche Öffentlichkeit genannt haben, weiter ungebremst voranzuschreiten. Die Politik hat überhaupt gar kein Gefühl dafür entwickelt, dass sie selbst Treiber dieser Zerstörung von rationaler Öffentlichkeit ist.
Jonas Zipf: Das ist wirklich beunruhigend. Zumal die Polarisierung hier in Thüringen ja schon sehr weit vorangeschritten ist und wir die hier kommende Landtagswahl vermutlich als die schwierigste aller Wahlen dieses Jahres erleben werden. Kein Mensch weiß, ob jenseits der AfD oder diesseits der AfD eine Mehrheit möglich ist. Sie haben ja vorher gesagt „Bonn ist nicht Weimar“, und da musste ich unwillkürlich zucken. Sie werden mir als Historiker jetzt wahrscheinlich vehement widersprechen, wenn ich die Situation der ausgehenden Weimarer Republik mit der heutigen Situation vergleiche. Andererseits haben sie viel zu rechten Kontinuitäten geforscht und geschrieben. Man könnte in dieser Überschrift Bonn auch ersetzen mit Berlin und sich dann befragen, wie es weiter geht bzw. in historischer Analogie weiter gegangen ist. Ich will diesen Aspekt jetzt nicht unnötig dramatisieren und auch nicht den Pessimismus zu groß werden lassen, aber: Die Situation in Thüringen ist extrem volatil, und das will ich nochmal aus der kommunalpolitischen Perspektive spiegeln. Das, was letztes Jahr nach der Ministerpräsidentenwahl von Herrn Kemmerich mit den Stimmen der AfD noch moralisch als Dammbruch bezeichnet wurde, bei dem richtigerweise versucht wurde, eine klare Grenze zu ziehen, das ist in der Zwischenzeit weiter vorangeschritten. Ich meine damit nicht nur die Polarisierung oder auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, Auflösung einer bürgerlichen Öffentlichkeit, sondern auch die ganz konkrete realpolitische Zusammenarbeit zwischen Akteuren der AfD und Akteuren anderer Parteien auf den kommunalpolitischen Ebenen. Schon nach der letzten Landtagswahl gab es bekanntlich CDU-Landräte, die die Frage öffentlich gestellt haben, wie eine Zusammenarbeit mit der AfD aussehen kann, und mittlerweile ist das einfach de facto der Fall. Wir erleben das jetzt in Gera mit einem Stadtratsvorsitzenden der AfD, der alle Rechte und Formalia eines Stadtratsvorsitzenden genießt und auch nutzt oder bei der Diskussion, ob Herr Maaßen als Direktkandidat für einen Thüringer Wahlkreis bei der Bundestagswahl antritt. Oder, ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel aus meinem Bereich, wie ein Kollege, der Intendant am Theater in Gera-Altenburg sich im Kulturausschuss der Stadt Altenburg anhören muss, dass das Geld, das über Kurzarbeit vom Bund in die Kasse des Theaters gekommen ist, das also eigentlich zur Krisenbewältigung und zur Absicherung der Institution und der Arbeitsplätze da ist, an die Kommunen zurückzuzahlen sei, weil dieses Theater seinem öffentlichen Bildungsauftrag ja sowieso schon längst nicht mehr gerecht würde und die Bevölkerung auch schon lange nicht mehr erreiche. Das ist der Zungenschlag, den die AfD und andere, dort dann auch anscheinend nahezu mehrheitsfähig, in die Debatte reinbringen. Da ist dann von Freiheit der Kunst überhaupt keine Rede mehr. Es wird geradezu übergriffig. Ich mache mir größte Sorgen, weil wir genau diese Zungenschläge ab Herbst – ich habe ja vorhin gesagt: „Nach der Staatskrise ist vor der Staatskrise“ – wieder und in verschärfter Form zu hören bekommen könnten. Umgekehrt könnten wir allerdings, wenn wir ehrlich sind, eine Partei in der Regierung behalten, die auch nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Die Vergleiche zwischen rechts und links sind überhaupt nicht statthaft, ich bin kein Anhänger von Hufeisen- oder Extremismus-Theorien. Aber wir können doch zumindest einen gewissen Populismus auch auf der linken Seite erkennen, wie ich finde, auch angesichts des Schlingerkurses in der aktuellen Situation. Das ist alles andere als vertrauenerweckend und demokratiebestärkend. Ich habe jedenfalls größte Sorgen, wie das in diesem Jahr läuft. Die historischen Einordnungen sind mir dabei systematischerweise nicht klar, aber die Parallele ist schon frappierend, dass wir heute eine starke AfD im Freistaat Thüringen erleben und dass es damals in der Weimarer Republik mit der NSDAP ja auch so war. Jetzt werden Sie wahrscheinlich mal als Historiker sprechen und mich ein bisschen einnorden.
Norbert Frei: Nein, ich habe da gerade an diesen Beispielen, die Sie jetzt herangezogen haben, beispielsweise an ihrer Schilderung, wie einem Theatermann begegnet wird, überhaupt nichts zu korrigieren. Das ist nicht gänzlich anders als in den späten Zwanziger- oder frühen Dreißigerjahren. Nein, es ist von der Argumentationsstruktur her ganz, ganz ähnlich. Den Zungenschlag, dass die Stimmen und Erwartungen und Meinungen des Volkes nicht abgebildet würden und dass das ein Argument gegen die Kultur der Republik, gegen die demokratische Kultur ist, das kennen wir aus der Spätphase der Weimarer Republik und insbesondere auch aus den Regionen, in denen die Nationalsozialisten und die Völkischen besonders früh besonders erfolgreich gewesen sind. Insofern kann ich Ihre Besorgnis nur teilen und auch das, was Sie über Populismus von links gesagt haben. Auch da kann man sich – ohne dass ich da jetzt konkrete Vergleiche ziehen will – erinnert fühlen an phasenweise Kooperationen, die es in der Spätphase der Weimarer Republik zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten gegeben hat, etwa beim Blick auf den Berliner BVG-Streik 1932 als dem sicherlich bekanntesten Beispiel. Ja, insofern würde ich tatsächlich sagen: Eine Thüringer Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten ist doppelt aufgerufen, sich dieser Risiken und Gefahren bewusst zu sein.
Jonas Zipf: Dann lassen sie uns noch ein bisschen nach vorne wenden. Ich habe ja selbst versucht, mir auf die Zunge zu beißen, gerade eben, weil unser Sprechen fast nur noch pessimistisch klingt. Sprechen wir also über Chancen, wenn es um die Gestaltung von Transformation geht. Wir haben vorhin von Veränderung gesprochen, oder auch von Veränderungsdruck, der auch über aktivistische Kreise ausgeübt wird. Ich spreche in diesem Zusammenhang gern von Transformation, weil dieser Begriff zum Ausdruck bringt, zumindest so wie Karl Polyani ihn eingebracht hat, dass es darum geht, die Kräfte und Akteure mitzunehmen und in etwas Neues aufzuheben, wenn man so möchte. Das hat also eine inklusive Komponente, wenn man diesen Begriff aufgreift, so, wie ihn ja auch die Soziolog:innen hier an der Jenaer Universität sehr stark machen.
Norbert Frei: Ja, wir arbeiten in unserem Verbundprojekt sehr stark mit dem Transformationsbegriff: Transformation, die in der späten DDR einsetzt und die eben über die politische Zäsur von 1989/90 hinausgeht. Man könnte ja sagen, dieser Transformationsprozess, der zurückreicht bis in die Siebzigerjahre, hat im Osten Deutschlands seitdem nicht mehr wirklich aufgehört. Das deutet natürlich auch an, dass es eine gewaltige gesellschaftliche Anstrengung ist, die jetzt schon länger als eine Generation – also in der traditionellen Berechnung von Generationenabfolgen von 30 Jahren – andauert. Insofern scheint mir die Situation mit dieser starken Rechten in den ostdeutschen Bundesländern auch Ausdruck dieses Transformationsprozesses zu sein.
Jonas Zipf: Jetzt wende ich genau das mal positiv und stellte es in den Gegensatz zur bundesrepublikanischen Vergangenheit und Gegenwart der sog. alten Bundesländer. Ich denke an meine Elterngeneration, die damit aufgewachsen ist, dass sich die Dinge nach dem Krieg vermeintlich erst mal nur zum Positiven gewendet haben, ein ständiger Wachstumstraum der Moderne sozusagen. Meine Eltern haben keine großen Disruptionen erlebt, und meine Generation und die danach schon gar nicht mehr. Im Gegensatz dazu haben Ostdeutsche eine Transformationserfahrung, eine laufende, wie Sie gesagt haben, erlebt. Und vielleicht – ich will es mal positiv wenden – ist dieser Teil des Landes besonders prädestiniert dafür, dieses Ringen um die politische Mehrheit im Sinne der Transformation auszuhalten, auszutragen, weil man eine ähnliche historische und auch biographische Erfahrung schon gemacht hat. Eines meiner Gespräche, die ich geführt habe, ergab sich mit Thomas Oberender, dem Generalintendanten der Berliner Festspiele, der in Jena geboren wurde und den diese ganze Corona-Situation – wohlgemerkt: im Frühjahr des letzten Jahres, nicht mehr jetzt, sondern am Anfang der Pandemie – an das erinnert hat, was er eine Generalpause und Generaldebatte nannte. Also daran, dass es auch Momente des Aufbruchs und der Offenheit 1989/90 gab, einen möglicherweise dritten Weg und Ähnliches zu diskutieren und zu gehen. Er fühlte sich in der jetzigen Situation daran erinnert. Das wäre jetzt vielleicht mal ein Punkt, den wir gegen den Pessimismus setzen können: Wenn Bevölkerungsteile hier im Osten, in Thüringen und anderswo existieren, die solche Krisenerfahrungen in ihrer Lebenszeit schon mal erlebt und zu Teilen sogar positiv absolviert haben, dann könnte das auch eine Chance sein für das, was Psychologen Resilienz nennen, um durch so eine Krise durchgehen zu können.
Norbert Frei: Absolut, das würde ich in jedem Fall so sagen. Und ich würde auch noch einmal dick unterstreichen: Wenn ein Viertel der Wähler in den ostdeutschen Bundesländern die AfD wählt, dann haben wir eben drei Viertel, die sie nicht wählen. Auf diese Trivialität muss man immer wieder hinweisen. Diese drei Viertel, die nicht AfD wählen, sind ja doch genauso wie die anderen 25 Prozent durch diese Transformationserfahrung gegangen, und sei es nur als Kinder oder Heranwachsende. Und die gehen, das würde ich tatsächlich so sagen, anders in die Zukunft als die Westdeutschen, als der westdeutsche Teil der heutigen bundesdeutschen Gesellschaft. Auf der anderen Seite würde ich sofort hinzufügen: Dieses Gefühl, dass Sie gerade beschrieben haben und das in den älteren Teilen der heutigen westdeutschen Gesellschaft lange vorherrschte, dass es also den Jungen immer besser gehen wird, das verflüchtigt sich doch schon seit einiger Zeit. Ja, das war ein jahrzehntelanges Credo – nach dem Motto: Wenn man nur tüchtig ist und sich anstrengt, dann kann und darf man Zutrauen in die weitere Entwicklung haben. Ich will nicht sagen, dass dieses Gefühl völlig verschwunden ist, aber doch, dass es durch die Corona-Krise noch einmal schwächer wird. Dabei besteht der Unterschied zwischen den jungen Menschen im Osten und denen im Westen weniger in der gesamtgesellschaftlichen Zukunftserwartung, als darin, dass die im Westen immer noch vielfach darauf setzen können, dass ihre Eltern Vermögen akkumulieren konnten, während das im Osten einfach nicht möglich war. Ansonsten scheint mir aber der Blick der Jüngeren in Ost und West auf die gesellschaftliche Situation gar nicht so unterschiedlich zu sein.
Jonas Zipf: Ich greife ihre Formulierung eines sich verflüchtigenden Gefühls auf. Denn sicher gibt es da noch Teile der Gesellschaft, die das alte homogene Gefühl der Beständigkeit noch tragen. Gestern in der Vorberichterstattung zur Wahlsendung im ZDF, da war ein junger Fußgänger zu hören, ich glaube in der Fußgängerzone von Heilbronn, wenn ich es richtig identifiziert habe: Der sagte, es sei doch alles gut, Opa Winni sei ja noch da. Das passte perfekt zum Slogan „Sie kennen mich“, und das war ein jüngerer Wähler, vielleicht Mitte 20, der dieses Sicherheits- und Lebensgefühl in die Kamera spiegelte. Aber bleiben wir beim Begriff der Transformation und versuchen, diesen Übergang zu begreifen. Etwas, Vieles verändert sich nun, das alte Opa-Winni-Gefühl ist im Abschwung begriffen. Insgesamt ist die Situation volatiler geworden, herrscht ein größeres Gefühl von Unsicherheit vor. Aber die sog. Große Transformation wird nur dann gelingen, wenn sich dieses Gefühlt positiv umwandelt. Dann lautet die Frage, die sich mir stellt: Welchen äußeren politischen Ausdruck findet dieser Gefühlswandel? Wir haben ja gesagt, ich binde das jetzt zurück und komme nochmal, gleichsam in einer Kreisbewegung, zum Ausgangspunkt des Gesprächs zurück: Wir sprechen im Kontext eines Superwahljahrs, eines Wahljahres, das einerseits, könnte man sagen, vom Timing her zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt. Wir bräuchten jetzt Stabilität in der Exekutive und keinen Wahlkampf, der das Krisenmanagement beschädigt. Andererseits könnte man sagen, gerade weil diese transformatorischen Themen so dringend anstehen, ist es der perfekte Zeitpunkt. Weil jetzt die Chance besteht, den politischen Wechsel zu gestalten. Und in der Tat: Wir stehen – ganz egal, was oder wer kommt – vor einem epochemachenden Wechsel. Frau Merkel wird nicht mehr weiter Kanzlerin sein, unabhängig davon, was nach ihr passiert. Das ist an für sich schon eine bedeutsame Veränderung. Sie verkörpert das Lebensgefühl, mit dem ich jetzt auch im Wesentlichen, ich bin 38 Jahre alt, mein ganzes Leben verbracht habe. Und das lässt sich schon als Fortsetzung des Lebensgefühls der Generation Golf der Zeiten von Helmut Kohl beschreiben, jener Generation der Sicherheit, Geborgenheit und Beständigkeit. Ich spreche von einem Lebensgefühl als Kind, als Jugendlichem und jungem Erwachsenem, der kein anderes Land, keine andere Gesellschaft erlebt hat, als das unter Kohl und Merkel. Denn zwischen Beiden gab es im Wesentlichen praktisch die Fortsetzung derselben Politik, nur unter anderem Vorzeichen oder anderer Überschrift, namens Rot-Grün. Die Zeit steht still in einer kondensierten, zugespitzten Form. Damit meine ich nicht nur Corona, aber Corona spitzt die schon vorhandene Zuständlichkeit zu: Nichts geht nach vorn, nichts geht zurück. Man fühlt sich wie vor dem Spiegel in dem berühmten Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Höhepunkt und sinnbildliche Zuspitzung der Politikzeit von Frau Merkel. Doch jetzt kommt eine Veränderung. Die große Frage lautet: Wie geht es weiter? Welchen äußerlichen politischen Ausdruck findet diese Transformation? Lassen sie uns noch ein bisschen spekulieren.
Norbert Frei: Ja, in der Tat, subjektiv erleben wir momentan das Gefühl des totalen Stillstandes, aber faktisch sind doch ungeheure Prozesse im Gang. Wir wissen das zwar, und es wird ja auch kommuniziert. Es tritt nur nicht so sehr an die Oberfläche, da dort die immer gleichen Corona-Informationen vorherrschen. Denken sie aber nur an den dramatischen Wandel, der einem Kernstück der deutschen Wirtschaft, nämlich der Automobilindustrie, ins Haus steht beziehungsweise der längstens im Begriffe ist. Oder nehmen Sie die Digitalisierung: Wie trotz allen Gekrächzes über die Unvollkommenheit aller möglichen Akteure die digitale Infrastruktur jetzt vorangetrieben wird und vor allem, in welcher nahezu die gesamte Gesellschaft erfassenden Weise die Bedeutung dieser digitalen Infrastruktur jetzt anerkannt wird. Oder auch das Feld der Europapolitik, auf dem sich trotz des ständigen Gemäkels, trotz der Krise bei der Impfstoffbeschaffung, die Erkenntnis durchsetzt – und das war für mich ein Lichtblick im vergangenen Jahr –, dass die durch Corona ausgelöste ökonomische Krise nur mit der faktischen Anerkennung der Notwendigkeit von Eurobonds zu lösen ist. Immerhin hat die ausgehende Bundesregierung hier nochmal einen Paradigmenwechsel vorgenommen, der wahrscheinlich nur mit dem nach Fukushima vergleichbar ist. Insofern gibt es in den Tiefenschichten der Politik dann doch mehr Bewegung als an der Oberfläche. Aber klar ist: Im Herbst dieses Jahres werden wir dann auch eine radikal gewandelte Oberfläche haben. Und auf dieser Oberfläche werden die Grünen eine zentrale Rolle spielen, so oder so; ganz egal, welche Hoffnungen sich jetzt wer macht, wer mit ihnen koalieren kann und darf. Mit den Grünen besteht zumindest eine Chance für eine weitgehende ökologische Transformation, wie sie seit den späten Neunzigerjahren nicht mehr gegeben war. Denn dass diese Chance unter Rot-Grün, also nach Kohl und vor Merkel, weitgehend vergeigt worden ist, das sehe ich wie Sie. Und mir scheint auch, dass viel von der Kohl‘schen Politik gewissermaßen unsichtbar von Rot-Grün weitergeführt oder sogar vollendet worden ist. Insbesondere wenn wir an die Steuer- und Finanzpolitik, aber auch die Arbeitsmarktpolitik denken.
Jonas Zipf: So gesehen, müsste es nun doch wirklich eine transformatorische Zäsur geben. Denn die Kernthemen – das finde ich sehr richtig beschrieben, und in der Zwischenzeit tatsächlich durch Corona beschleunigt – laufen im Hintergrund. Ich möchte diesen einen Punkt dabei nochmal herausheben: Dieser Paradigmenwechsel, was die Fiskalpolitik auf europäischer Ebene anbelangt, war ja über Jahrzehnte nicht zu denken. Das ist der de-facto-Einstieg in das, was die CDU immer als Haftungsgemeinschaft bekämpft hat. Überhaupt ist im Bereich der Haushaltspolitik einiges in Bewegung gekommen. Bei allen Beschwerden, bei allen berechtigten Kritiken an der Europäischen Union, schließt sich daran für mich eine zweite bemerkenswerte Reflexion der europäischen Frage an: Die Erfahrung, dass Grenzen geschlossen wurden, wirkte einigermaßen traumatisch. Danach gab es plötzlich eine sehr klare Haltung der Mitgliedsstaaten, dass man die Impffrage doch gemeinsam lösen müsse. Auch das war und ist gerade angesichts der fortwährenden Schwierigkeiten bei der Impfstoffbeschaffung einigermaßen erstaunlich.
Jetzt will ich das alles kurz bündeln und zusammenführen: Aus meiner Sicht gibt es drei große Transformationsfelder, die wir auch benannt haben: Nachhaltigkeit / Klimawandel wäre das erste, Digitalisierung das zweite und das dritte, das haben wir vielleicht so noch nicht benannt aber zumindest gestreift, das bezeichne ich mit Inklusion, also der Frage, wie gesellschaftlicher Ausgleich über verschiedene Gruppen und Schichten hinweg weiterhin gelingen kann. Das würde doch jetzt – lassen Sie uns am Schluss noch weiter spekulieren und zwar gerne anhand der realpolitischen Kräfte, die da sind – fast für das sprechen, was sich gestern am Wahlabend als Tenor hinter vorgehaltener Hand abzeichnete, nämlich die Kombination der sog. Ampel: Eine Partei, die ganz stark an der Digitalisierung arbeitet; eine, die für das Klimawandelthema steht, und eine, die vielleicht zumindest in Teilen das Inklusionsthema wiederentdeckt hat. Was meinen Sie? Was kommt da raus, in diesem Jahr?
Norbert Frei: Ich möchte erst einmal ergänzen und bestätigen, dass wir an den doch massiven Veränderungen in einigen Unterströmungen auch des vergangenen Jahres gesehen haben, dass ihr dritter Punkt der Diversität oder Inklusion, also der stärkeren Sichtbarkeit von Minderheiten – auch vor dem Hintergrund des Stichworts der Identitätspolitik, die insbesondere die SPD momentan so plagt – mit großer Rasanz unter dieser bleiernen Corona-Decke hervortreten. Ich glaube, das werden wir auch im Herbst bei der Bundestagswahl und der anschließenden Kabinettsbildung, ganz egal, wie die Konfiguration am Ende aussehen wird, deutlich erkennen können. Wir müssen nicht nur pessimistisch sein, sondern wir können auch mit einiger Zuversicht sehen, dass die demokratischen Parteien – da würde ich jetzt keine ausnehmen – in der Lage sind, diese enormen gesellschaftlichen Veränderungen aufzunehmen, die sich da gerade entwickeln, beispielsweise die stärkere Artikulationskraft von gesellschaftlichen Minderheiten. Und um im dritten der von ihnen genannten Felder zu bleiben: Ich hoffe, dass wir auf diesem Weg und in dem Maße, in dem die berechtigten identitätspolitischen Anliegen auch tatsächlich noch stärker in der Alltagspolitik ankommen und repräsentiert werden, dann auch wieder über die gegenwärtig zu beobachtenden Übertreibungen hinwegkommen können. Das sollte und muss mit dem ja doch zu erwartenden neuen Spitzenpersonal auch auf den anderen Feldern gelingen!
Jonas Zipf: Das ist doch ein perfektes, ein hoffnungsvolles Schluss-Statement. Ich freue mich sehr, dass wir noch den Weg in die Hoffnung gefunden haben. Herr Frei, vielen Dank für das Gespräch.
Norbert Frei: Vielen Dank Ihnen. Bis zum nächsten Mal!
Jonas Zipf: Bis dann.
—
*Norbert Frei, Historiker, hat den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne und leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts.
—
Geht es Ihnen wie uns und Sie verfolgen die Corona-Gespräche deshalb mit Interesse, weil sie es jenseits der persönlichen Befindlichkeiten in der Pandemie vermögen, den Blick zu weiten, zu heben und das Große und Ganze zu reflektieren? Wir freuen uns über Ihre Feedbacks und laden sehr herzlich zum Dialog ein!