Es hat eine ganze Weile gedauert, bis Jonas Zipf Aleida Assmann erreichen konnte. Gewissermaßen stellt sie im Rahmen der Jenaer Corona-Gespräche die große Ausnahme dar: Das Gespräch mit ihr verdankt sich keinem spontanen Anlass. Es kam auf Wunsch zustande und sollte dabei helfen, eine schmerzliche Lücke des bisherigen Diskurses der anderen Gespräche wenigstens ein wenig zu heilen. Mit Aleida Assmann diskutiert Jonas Zipf im Kern über die Frage, wem die gesellschaftlichen Bühnen gehören, auf denen sich Kultur, Erinnerung und Politik ereignen. Wem sie gehören, wer sie sich aneignet und wer dort unter welchen Bedingungen spricht. Auch hier wirkt Corona wie ein Brennglas. Eine jede Stadt geht ganz offensichtlich eigene Wege, so auch Jena im Zusammenhang mit dem sog. NSU. Wenige wissen, das so gut einzuordnen wie Aleida Assmann …
JONAS ZIPF: Frau Assmann?
ALEIDA ASSMANN: Am Apparat, ja. Hallo.
JONAS ZIPF: Hallo. Hier Jonas Zipf. Schön, dass das klappt.
ALEIDA ASSMANN: Freut mich ebenso.
JONAS ZIPF: Auch wenn wir uns jetzt quasi nur virtuell kennenlernen, vielleicht soll ich Ihnen zu Beginn mal ganz kurz den Kontext erläutern?
ALEIDA ASSMANN: Sehr gerne, ja.
JONAS ZIPF: Also. Wir sind ein städtischer Eigenbetrieb hier in Jena, den leite ich seit vier Jahren. Dies ist insofern eine Besonderheit, weil dieser Eigenbetrieb alle städtischen Einrichtungen der Kultur und der kulturellen Bildung beinhaltet, aber daneben auch solche Themen wie Kunst im öffentlichen Raum, Tourismus und Stadtmarketing verantwortet. Von daher beschäftigt uns auf unterschiedliche Weise auch immer wieder das Thema Gedenkkultur. Von der Corona-Krise sind wir natürlich mit all den Einschränkungen für die Veranstaltungstätigkeit stark betroffen, wie so viele, und haben uns von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie wir die Krise auch als Chance verstehen können. Momentan sind wir stark mit Krisenmanagement beschäftigt, ganz konkret für die Kommune, wir unterstützen das Gesundheitsamt, wir versuchen auch die Zukunft für die eigene und alle übrige Kultur mit fortgesetzter Lobbyarbeit abzusichern.
Gleichzeitig finde ich, gerade als Kulturakteur ist diese Zeit vor allem auch ein Moment des Innehaltens. Unsere Corona-Gespräche, so nenne ich sie mittlerweile, haben sich zu Beginn der Krise eher spontan entwickelt.
Zuerst mit dem Soziologen Hartmut Rosa, dann mit Thomas Oberender, und Bernhard Maaz. Beide sind mir als Chefs anderer großer Kultureinrichtungen wesensverwandter, wenn man so möchte…
ALEIDA ASSMANN: Ja, also das Gespräch geht weiter, in anderen Worten, ja.
JONAS ZIPF: Genau. Ich denke, dass man nachher, über diese Gespräche hinweg sehr gut ablesen kann, wie diese Krise en détail verlaufen ist. Es gibt ja unterschiedliche Phasen. Am Anfang war die Situation bestimmt noch viel mehr davon geprägt, dass man die Ärmel hochkrempelt und aufbricht. Und mittlerweile wird langsam absehbar, wer hier wem welche Rechnungen stellt und welche politischen und gesellschaftlichen Scharmützel sich daran für die nächsten Monate und Jahre noch knüpfen werden, so.
ALEIDA ASSMANN: Ja, das ist jetzt offen, wie wir da rauskommen.
JONAS ZIPF:. Ich würde gerne einsteigen mit einem kulturellen Impuls. Es gibt ein Film- und Musikprojekt von 1990. Damals war schon mal die Rede vom Ende der Geschichte. Ein britischer Künstler, Kevin Godley, Regisseur und Musiker, hatte sich aufgemacht und weltweit Musiker versammelt, die eine Stunde lang live Musik zusammen gemacht haben. Es ging damals besonders um Klimaschutz, unter dem Titel „One World, one Voice“. Das Projekt entstand mit Live-Schalten per Satellitentechnik, war damals absolut bahnbrechend, 1990 war das noch neu, da steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Das Prinzip bestand in einer musikalischen Verständigung über alle Grenzen hinweg. Godley hat mit Musikern aus aller Herren Länder eine Stunde in einer Art Chain Tape live Musik gemacht. Es gab eine Timeline für eine Stunde Musik und jeder konnte improvisieren. Es waren über 100 Musiker beteiligt…
ALEIDA ASSMANN: Und Alle konnten einfach improvisieren? An einem Thema oder was sie wollten?
JONAS ZIPF: Melodisch und harmonisch? – Was sie wollten!
ALEIDA ASSMANN: Ein Nebeneinander, das war also ein Nebeneinander?
JONAS ZIPF: Genau. Es gab eine Grundstruktur, die war vorgegeben. Die Musiker*innen wussten: Okay, der Rhythmus wird die nächsten fünf Minuten von Peter Gabriel gespielt oder von Sting oder von den Leningrader Symphonikern. Und auf diese Grundstruktur konnten andere Musiker dann, so wie beim Jazz, improvisierte Soli spielen.
ALEIDA ASSMANN: Interessant.
JONAS ZIPF: Ein sehr, sehr beeindruckendes Projekt, es ging, wie gesagt, nur eine Stunde, aber es hat damals große Wellen geschlagen, wurde in vielen Fernsehsendern live gesendet. In Deutschland hat es die ARD live übertragen. Ich war damals acht Jahre alt, mein Vater hat das mit mir angeschaut, spät in der Nacht, ich durfte das erste Mal lange wach bleiben. Andere haben vielleicht Erinnerungen an die Mondlandung oder Boxkämpfe von Muhammad Ali, aber für mich war das quasi so eine Art Initiation. Und das Irre war, dass es so eine physische Kopräsenz gab über die räumliche Distanz hinweg und natürlich mit einer universellen Sprache, mit Musik eben. Es war ein einmaliges Ritual, wenn man so möchte, natürlich auch ein Kulminationspunkt der großen Konzertveranstaltungen der 80er, Live Aid etc., was es da alles gab. Aber auch ein Auftakt für das, was wir jetzt ja wieder erleben, dass es eben im digitalen Raum zu einer Art Gemeinschaft kommt. Die Balkonkonzerte, der Applaus an den Fenstern und solche Elemente, der Versuch sozusagen, Gemeinschaft über eine Distanz hinweg zu stiften, hat mich genau daran wieder erinnert. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen – über die Frage, wie diese Gemeinschaft funktioniert, wie sie sich anhand von Kultur und kollektiver Erinnerung konstituiert? Wir befinden uns ja auch in einer richtigen Zerreißprobe, sowohl für uns als Gemeinschaft, aber und auch im internationalen Maßstab.
Ich kann mich als Ihr Fan outen, ich habe Sie oder Ihr Denken, Ihr Schreiben kennengelernt, über die Lektüre des „Europäischen Traums“. Sie betonen da, dass es zur Konstitution einer Gemeinschaft – gerade, wenn diese über nationale Grenzen hinweg reichen soll – der gemeinsamen Einübung kultureller Praktiken und Rituale bedarf. Unter anderem fordern Sie gemeinsame europäische Feiertage, allen vorneweg den 8. Mai, den Tag, den Bundespräsident Richard Weizsäcker im Bonner Bundestag als „Tag der Befreiung“ bezeichnete. Die Frage nach einem derartigen europäischen Traum empfinde ich als einen beeindruckenden Ansatz. Und phasenweise konnte man schon auf die Idee kommen, dass es einen großen Verlierer dieser Corona-Krise gibt, nämlich die europäische Gemeinschaft.
ALEIDA ASSMANN: Ich hoffe, dass das nicht das letzte Wort bleibt. Es ist ganz klar, dass der Nationalstaat erst mal wieder an Bedeutung gewonnen und die Kraft der EU damit eingeschränkt hat. Das zeigt sich an Auseinandersetzungen, die im Entweder-Oder-Modus geführt werden, wie etwa die rund um Corona-Bonds. Das sind Diskussionen, die ständig auf der Kippe stehen. Aber das ist für meine Begriffe genau der falsche Ansatz, weil Nation und EU zusammengehören und nicht ohne einander gehen. Und vor diesem Hintergrund habe ich aber dann doch den Eindruck gehabt, dass der Kampf für die EU noch nicht verloren ist. Im Gegensatz könnte man sich ja auch mal vorstellen, man lebte jetzt in England, man wäre gerade aus der EU herausgekommen mit einem intensiven Kollektivaufwand. Einer Anstrengung, die einen selbst schon stark erschöpft hat, und nun wird man von Corona überfallen. Das ist keine gute Situation. Wir wissen alle, dass diese Konzepte „Britain first“, „America first“, „India first“… zerschellt sind und niemand sie noch ernsthaft propagieren kann. Wir haben doch gerade gelernt, wie sehr wir auf Gegenseitigkeit angewiesen sind. Das ist mir ein wichtiges Anliegen: Die Verbundenheit in einer grenzübergreifenden Krise wie dieser sollte uns doch alle darin erinnern, Europa nicht zu vergessen! Dass diese Verbundenheit für ein paar Wochen zurückgestellt werden musste, das stimmt. Es trifft auch zu, dass es so etwas gab wie einen Pandemie-Wettbewerb der Nationen, eine Konkurrenz um Ressourcen für den Infektionsschutz. Aber es wurde auch deutlich, dass man sich im Grunde nicht voneinander abspalten kann, insbesondere nicht auf dem ökonomischen Sektor. Die Rettungsschirm- und Stabilitätsmechanismen offenbaren doch die Erkenntnis: Wenn andere Staaten kollabieren, kollabieren wir auch. Also stehen wir letztlich in einem Verhältnis zueinander, das so ähnlich funktioniert wie im Kleinen, wie im Alltag der Pandemie. Ich nenne das mal die „Corona-Grammatik des Miteinanders“: Meine Maske schützt dich, und deine Maske schützt mich. Längst erleben wir interne Überquerungen in den Beziehungen zwischen den Menschen und können diese einfach nicht mehr auseinanderschneiden. Das geht auf der Interaktionsebene nicht mehr, da entsteht so etwas wie eine kollektive paradoxe Nähe. Und es geht auch nicht mehr auf der nächsten Ebene oberhalb des Nationalstaats, würde ich sagen…
JONAS ZIPF: Ich spiele jetzt den Antipoden und versuche, zu beschreiben, was mich dennoch und weiterhin traurig stimmt. Die größte Motivation zur multilateralen Zusammenarbeit innerhalb Europas fußt immer noch auf der wirtschaftlichen Argumentation. Also das, was Sie jetzt auch nochmal hergeleitet haben, ist ja letztlich die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Wir stärken den erweiterten Binnenmarkt; daher müssen wir die schwächeren Teile Europas jetzt auch stützen, damit wir gut aus der Krise kommen. Das sind bekannte politische Haupt-Narrative, wie sie momentan bedient werden. Man könnte das positiv wenden und sagen: Ohne diesen pragmatischen Wohlstandserfolg wird man auch keine Überzeugung über verschiedene politische Lager und Nationen hinweg organisiert bekommen. Aber negativ gewendet, geht es doch darum, den Mangel der Beschreibung Europas als kulturelle Gemeinschaft, meinetwegen auch als kulturelle Schicksalsgemeinschaft, zu thematisieren. So verstehe ich ja auch Ihr Plädoyer für eine gemeinsame Erinnerungskultur in Europa. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir in unserer Lebenszeit die längste Phase der Prosperität und des Friedens der Geschichte Europas erleben. Wir könnten auf dieses multilaterale Erfolgsmodell stolz sein, für das die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat. Stattdessen scheinen jetzt, in der Krisenphase einer Pandemie, Grenzschließungen wieder ein Mittel der Wahl zu sein. Da kommt ein Virus, und ganze Regionen kapseln sich ab und müssen sich vermeintlich voreinander schützen, selbst innerhalb der förderalistischen Bundesrepublik Deutschland. Ich empfinde es als absurd, dass sogar die frühere deutsch-deutsche Grenze phasenweise wieder geschlossen wurde.
ALEIDA ASSMANN: Ja, ja, Grenzen und Grenzen. Also zunächst mal ganz wichtig und richtig, hier über die Wirtschaft zu sprechen. Wenn Sie mein Buch über den europäischen Traum gelesen haben, merken Sie, dass ich diese ganze Dimension eigentlich außen vor halte und mich auf ganz andere Dinge konzentriere. Zwei davon, aktuell in jedermanns Munde, sind: das Friedensprojekt und das Demokratisierungsprojekt. Insofern steckt die Wirtschaft bei mir schon drin, da die Wirtschaft ja die wirkungsvollste Strategie der Friedenssicherung war. Wenn man tatsächlich die Ressourcen der Kriegswirtschaft, und der NS-Staat war nichts anderes als eine gigantische expandierende, explodierende Kriegswirtschaft, wenn man diese Ressourcen, nämlich Kohle und Stahl, vergemeinschaftet und zur Grundlage einer gemeinsamen Wirtschaft macht, von der dann alle beteiligten Seiten einen Vorteil haben, dann ist das im Sinne sowohl der Wirtschaft, als auch des Friedens, ein unglaublicher Einfall. Ich denke, wir müssen den beiden Franzosen, Robert Schuman und Jean Monnet, dafür ewig dankbar sein. Und es ist in der Tat so, dass die Wirtschaft, wenn man so will, das einigende Band war, das alle anderen Entwicklungen dann erst möglich gemacht hat. Wenn man so will, die tragende Grundlage. Aber nicht unter allen Bedingungen, denn Wirtschaft kann auch zerstören. Gerade die Regularien des Marktes können eine Eigengesetzlichkeit entwickeln und Europa ganz schnell auch wieder zerstören. Spätestens seit der Finanzkrise hat man da schon einiges dazu gelernt. Vor allem weiß man, dass ein Kapitalismus, wie er in China betrieben wird, also geopolitisch auf einer ganz großen Linie, eine unmittelbare Bedrohung für Europa sein kann. Denken Sie nur an den griechischen Hafen von Piräus, fast so etwas wie ein Zentralsymbol europäischer Identität. Hier ist der chinesische Staatskonzern Cosco Shipping bereits Mehrheitsaktionär, weshalb der Hafen aus dieser chinesischen Perspektive längst als Knotenpunkt der neuen Seidenstraße gilt und als „Kopf des Drachens in Europa“ bezeichnet wird. Ein derartiger Ausverkauf kann nicht funktionieren. Da müssten sich andere Formen zur Stärkung des eigenen Wirtschaftsraums finden, vor allem das Öffnen der Grenzen des Binnenmarkts. Schengen ist ein großes Beispiel und starkes Symbol für Europa. Und plötzlich war das weg: Europa war nicht wiederzuerkennen. Es war fast wie ein Ausgehen von Luft. Die Corona-Krise führt uns dieses Bild des Nicht-mehr-atmen-Könnens noch mal in doppelter, metaphorischer und schmerzlich konkreter Weise vor Augen.
JONAS ZIPF: I can’t breathe, ja?
ALEIDA ASSMANN: Ja, genau. I can’t breathe. Es gab so ein „I can’t breathe“ auch für Europa. Und zwar an dem Punkt, an dem Schengen ausgehebelt wurde, indem die Grenzen nahezu vollkommen geschlossen wurden. Ich wohne ja auch an einer Außengrenze Europas. Zwischen Konstanz und Kreuzlingen, mitten durch eine Stadt mit zwei Namen hindurch läuft diese Außengrenze. Da war es wirklich so, dass Familien plötzlich voneinander abgeschnitten waren und sich nicht mehr sehen konnten. Und diese Situation führte dazu, dass diese Klage immer lauter wurde. Für diese Leute ging es um Tage. Ein Tag länger oder kürzer hat einen spürbaren Unterschied gemacht. Man hat jeden dieser Tage mitgelitten, für diese Leute war es kaum aushaltbar. Das Wiederöffnen des Schengen-Raums, das war dann so ein richtig tiefes Luftholen. Ein Moment, der einem auch mal gezeigt hat, dass Europa ohne die Durchlässigkeit der Grenzen gar nicht funktioniert und dass dieses Gut etwas ist, das wir offensichtlich nicht wieder hergeben wollen. Mir kann niemand einreden, dass es da einen Trend in eine andere Richtung gibt. Im Gegenteil, würde ich sagen, diese Belastungsprobe hat gezeigt, wie wichtig das Überschreiten der Grenzen ist, das Leben an anderen Orten, die Binnenmobilität, die ja nicht unbedingt bedeutet, dass man in ein Flugzeug steigt, aber dass man Nachbarschaften ausdehnt über die Grenzen, über Sprachgrenzen hinweg. Das ist das Herz der Vielfalt Europas. Das alles hat mir die Lebendigkeit Europas, die abhängt von dieser Beweglichkeit, von dieser Bewegung, doch sehr deutlich gemacht.
JONAS ZIPF: Das heißt, dass das Erleben des Mangels an Bewegungsfreiheit in dieser Krise nochmal gezeigt hat, wie wichtig uns diese mittlerweile vielleicht schon ganz normal vorkommende Realität geworden ist. Gerade jemanden wie mir, mit Ende 30, der sich fast nicht mehr daran erinnern kann, wie das war, MIT Grenzen. Ein gutes Beispiel für ein konkretes Stück erlebtes Europa, bei dem der Unterschied der Entwicklungstempi zwischen wirtschaftlicher-finanzieller Integration und kultureller-gesellschaftlicher Integration vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie ich es aber dennoch insgesamt befürchte. Daher möchte ich darauf zu sprechen kommen, worin vielleicht ein zentraler Wert innerhalb dieser oft beschworenen Wertegemeinschaft bestehen könnte. Was uns Europäer im Zuge der Aufklärung ausmacht, ist so eine gewisse Nachdenklichkeit. Man könnte auch vom Diskurs reden, der Möglichkeit, sich über Dinge zu verständigen, und zwar auch über Sprachen und Grenzen hinweg. Aber jetzt frage ich mich: Findet dieser Diskursraum im Moment auf internationaler Ebene überhaupt noch statt?
Ich habe für mich selbst neulich eine recht irritierende Erfahrung gemacht: Wir hatten eine Einladung des Historikers Norbert Frei zu einer Tagung zum Ende des Zweiten Weltkriegs, rund um das Datum 8. Mai. Die Tagung fand dann leider coronabedingt im virtuellen Raum statt. Es gab Grußworte von Joschka Fischer und Wolfgang Schäuble, neben weiteren war Saul Friedländer eingeladen. Man konnte alle Beiträge online hören, und es gab natürlich auch ein Chat-Forum und dergleichen. Doch es entstand weder ein Diskurs, noch existierten die Zwischentöne, die am Rande einer solchen Konferenz so unentbehrlich sind. Die Monologe standen im Raum. Für uns als Betrachter blieb alles in der interpassiven Form. Es gab keinen echten Diskursraum, so wie ihn die Scientific Community sonst gewohnt ist, innerhalb dessen sich Menschen begegnen. Diese Begegnung ist etwas, was jetzt gerade auf der Strecke bleiben muss. Da bleibt eine Lücke, eine schmerzliche Lücke. Und ganz besonders, wenn es um so historische und kollektiv-emotionale Anlässe geht wie den 8. Mai. Wie erleben Sie das? Sie sind ja nun mitten drin im Wissenschaftskosmos…
ALEIDA ASSMANN: Ja, die Lücke ist außerordentlich schmerzlich. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass die virtuelle Kommunikation, auf die wir jetzt nicht nur zurückgeworfen sind, sondern die wir lange schon nutzen, oder: die uns „vernutzt“, dass diese Kommunikation auch schon einiges dazu getan hat, Zustände hervorzubringen, wie Sie sie jetzt beschrieben haben. Ich habe gerade ein Gespräch mit Mercedes Benz geführt über kulturelles Gedächtnis und Digitalisierung. Und da ist mir doch sehr deutlich aufgegangen, dass die Formen der Digitalisierung für den kommunikativen Austausch gar nicht unbedingt so sind, dass sie genau das stützen und stärken, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich Diskursräume zu öffnen. Das heißt ja, dass wir uns gemeinsam in einen Raum begeben und dem anderen auch mal zuhören und ihm Zeit lassen, auszureden oder überhaupt einen Gedanken zu fassen. Gemeint ist eine Ruhe, die da erst mal aufkommen muss, damit überhaupt auch was berührt wird und nicht nur ein dauerndes Hintergrundgeräusch hinter uns herläuft, sondern dass wir uns aufeinander einstellen und konzentrieren können und versuchen, Argumente aufzunehmen. Wenn wir dagegen jetzt den medialen, virtuellen Diskursraum betrachten, der in der Coronazeit auf Hochtouren weiterläuft, da geht es ähnlich zu, wie Sie es bei der Veranstaltung zum 8. Mai beschreiben. Innerhalb dieser Kanäle kommen wir nicht weiter. Man kann eine Position artikulieren, man kann sie sich vorstellen, man kann sie erklären, man kann sie wiederholen, aber es fügt sich nicht die eine Stimme mit der anderen zusammen, und es stellt sich auf diese Weise kein Prozess ein, in dem man gemeinsam weiterdenken kann. Man bleibt völlig für sich, isoliert, es dreht sich alles im Kreis. Ab der zweiten Woche wird wiederholt, was in der ersten Woche schon mal gesagt wurde, in der dritten ist die Welt noch enger geworden. Die Themen ziehen sich eher zusammen, als dass sie sich weiten. Der Reduktionismus schreitet voran. Nicht zuletzt, weil es im Interesse der Medien liegt, und nicht nur der digitalen, auch der Presse-Print-Medien, Debatten möglichst in Richtung Skandal zu drehen, so dass man immer ganz klare, schroffe Gegensatzprofile hinbekommt. Nur dann sei es interessant für Außenstehende, höre ich immer wieder. Das ist aber, glaube ich, eine falsche Unterstellung. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen auch Interesse daran hätten, Aufklärungsprozesse mitzuerleben oder sich daran zu beteiligen, an Aufklärungsprozessen für sich selbst. Das meine ich ganz klein und einfach. Ich spreche nicht von Vermittlung, Volksbildung oder Pädagogik, sondern davon, dass jeder etwas für sich lernen kann, aus den Dingen, die er gerade um sich herum erlebt. Mir kommt es darauf an, Zugänge zu den intellektuellen Debatten zu ermöglichen.
JONAS ZIPF: Ja. Tatsächlich besteht ein hohes Erkenntnis-Risiko darin, alles auf Effizienz zu verkürzen, auf die kleinstmögliche und bestverständliche Informationseinheit. Schon vor Corona hat der um sich greifende Populismus diese Entwicklung vor sich her getrieben. Und jetzt sind wir endgültig im Zeitalter der hemdsärmeligen Verkürzung und Reduktion von Komplexität angekommen. Die Beschleunigung der Digitalisierung und Virtualität trägt dazu bei. Aus Verwaltungsbesprechungen kenne ich Aussagen, die mich gruseln: „Endlich kein unnötiges Gerede mehr, Taten statt Worte.“ „So schnell und effizient waren wir noch nie, und wir mussten nicht mal dorthin fahren.“ „Ist doch super, es kann immer nur einer reden in der Telefonkonferenz, man muss es auf den Punkt bringen.“ usw.
Da gibt es irgendwann kein prozesshaftes, dialogisches, lautes Denken mehr; da werden wir irgendwann zu reinen Informationseinheitsträgern und Austauscheinheiten. Ich finde es ja ganz erstaunlich, dass eine ganze Gesellschaft zum puren Positivismus zurückkehrt und alles Iterative, Ungefähre, Offene mittlerweile fast radikal negiert. Entgegen dieser Entwicklung erlebe ich es als eine der größten Errungenschaften dieser Krise, dass sie die Denkprozesse der Naturwissenschaftler in ihrer Prozesshaftigkeit offenlegt. Eigentlich müsste doch gerade jetzt eine breite Öffentlichkeit live nachvollziehen, wie mühsam und fragil diskursive, wissenschaftliche, auch künstlerische Erkenntnisprozesse sind. Aber von Trial und Error, von „Fail and fail again, better“ will dennoch kaum einer was hören. Wir konstruieren lieber „Helden der Krise“, die wissen, wo es langgeht, nageln die Virologen auf vorläufige Aussagen fest und regen uns dann nach allen Regeln der Kunst auf, wenn die Annahme nicht aufgegangen ist….
ALEIDA ASSMANN: Genau. Die Naturwissenschaft exponiert sich in der Öffentlichkeit selbst. So sehe ich das auch. Die Naturwissenschaft, die ja jetzt wirklich die erste Stimme hat, demonstriert, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Es gehört eben beides zusammen: Die Sicherheit der Wahrheitsfindung der Wissenschaft auf der einen Seite, die wir überhaupt nicht in Frage stellen, dann aber eben auch das Prozesshafte der wissenschaftlichen Erkenntnis, der kreisende Prozess ständiger Korrekturen und selbstkritischer Befragung der vorliegenden Ergebnisse und des Wartens auf neue Ergebnisse, die dann wieder befragt werden usf. Und selbst wenn sich dann eine Hypothese als richtig erweist und Phänomene erklärt und erhärtet, muss immer noch ein Dritter kommen, der noch was hinzulegt und das Ergebnis noch mal befragt, verwirft und von vorne beginnt oder eben bestätigt. Wissenschaft ist immer ein extrem kollaborativer Vorgang. Es ist das genaue Gegenteil dessen, was Politik macht. Politiker stellen sich vorne hin und müssen klare Urteile darüber abgeben, wie es weiter geht, wo es langgehen soll. Ich möchte nicht in deren Rolle stecken. Das ist aber ihre Aufgabe, und da stoßen mit Wissenschaft und Politik ganz verschiedene Aufgaben und auch Wahrheitswelten aufeinander – der Autorität der Wirtschaft und der Autorität der Politik steht das Prozesshafte der Wissenschaft gegenüber. Wir können das im Moment zum ersten Mal öffentlich miterleben. Das finde ich großartig.
Wenn man mal die Wissenschaften nebeneinander stellt, die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften, die wir heute ja oft lieber Kulturwissenschaften nennen, dann besteht der größte Unterschied doch darin, dass sich die Naturwissenschaften nicht ständig in ihrem Kontext reflektieren, sondern darüber hinwegsehen können. Kulturwissenschaftler kontextualisieren, historisieren, selbstreflektieren alles, was sie sagen. Und wenn man immer daran denkt, was hat man gestern, vorgestern gesagt hat, dann ist das schon ein ganz anderer Schutz vor eigener Hybris. Man weiß, was die Formung ausmacht, die hinzukommen muss, um so eine Wahrheit dann auch wirklich zu etablieren. Die Wahrheit glänzt nicht so einfach aus sich selbst heraus.
Dazu fällt mir Eduard Rosenthal ein, der in Jena eine Lesehalle gestiftet hat. In einer Veröffentlichung habe ich den wunderbaren Satz von ihm gefunden: „Die Lesehalle ist die Zentralsonne, von der das Licht der Volksbildung ausstrahlt nach allen Seiten in unsere Stadt.“ Ich bin begeistert von diesem Satz, weil er den bürgerlichen Begriff der Einheit von Öffentlichkeit, Bildung und Wahrheit umschreibt. All das war in der Zeit des aufstrebenden Bürgertums noch so schön miteinander verknüpft. Und an dem Aufbau dieser zivilgesellschaftlichen Bildungskultur hatte die jüdische Bevölkerung einen riesigen Anteil. In diese Lesehalle konnten alle rein; es gab einen offenen Zugang zu dem Grundgut Bildung und zur Wahrheit und dem Licht der Aufklärung, das sich wie eine Sonne in alle Richtungen ausbreitet. Was ich damit sagen will: Die Lesehalle von Rosenthal ist nicht mehr das Modell der Medienwelt, in der wir heute leben. Wir wissen um die vielen Prozesse der Lenkung und der Rahmung, der Abschirmung und Abschottung und auch der Ungleichverteilung dieses Lichtes der Aufklärung, das eben nicht mehr so schön gleichmäßig in alle Winkel strahlt.
JONAS ZIPF: Also, das freut mich sehr, dass Sie diese für Jena so bedeutsame, aber außerhalb Jenas bisher so unbekannte Persönlichkeit zitieren. Ja, der Eduard Rosenthal besaß einen tiefen Glauben daran, dass das Ganze nur funktionieren kann, das ganze Konstrukt der Gemeinschaft eines Staates, wenn es so etwas gibt wie Teilhabe. Dafür waren Persönlichkeiten wie er wirkliche Pioniere. Es war bahnbrechend, dass zeiss hier in Jena, maßgeblich dank seines Mitwirkens, als weltweit erstes Stiftungsunternehmen auf den Weg gebracht, damit praktisch den Mitarbeitern übergeben wurde. Ein derartiges Bewusstsein und Engagement für Bildung und soziale Teilhabe der Mitarbeiter und Stadtbevölkerung, das war in dieser Zeit eine visionäre Innovation. In dem, was Sie als klares und schönes Bild einer Sonne der Aufklärung beschreiben, steckt ja nicht nur das Enlightenment einer Volksbildung, sondern auch die feste Überzeugung, dass unterschiedliche Meinungen und Wahrheiten nebeneinander bestehen können. Das können wir auf die Wissenschaft genauso beziehen wie auf eine demokratisch verfasste Gesellschaft. Das erste Haus der Stadt Jena, das Volkshaus, das in dieser Zeit entstanden ist, wo sich dieser Lesehallenverein und die Bücherei befunden haben, das verkörpert diesen Gedanken bis heute. Es ist ein Haus, das von vornherein politisch neutral und damit offen für alle Gruppierungen bleiben sollte, solange diese auch anderen das gleiche Recht einräumen. Und das mitten im Kaiserreich! Gegen starke Widerstände haben bürgerliche Liberale wie Rosenthal damals ermöglicht, dass die junge SPD ihre ersten Reichsparteitage in Jena abhalten konnte. Die wussten, dass Demokratie nur funktionieren kann, wie es Voltaires Diktum vorgibt, wenn jede Meinung gehört werden kann, wenn jeder Meinung eine Plattform geboten wird – solange ein Jeder dazu bereit ist, dem jeweils Anderen die Äußerung seiner Meinung zu ermöglichen, notfalls bei Einsatz seines Lebens, auch und sogar, wenn diese seiner eigenen 180° konträr gegenübersteht.
Da sind wir natürlich ganz nah an Ihrem zentralen Gedanken, dass Erinnerungskultur nur gelingen kann, wenn unterschiedliche gesellschaftlichen Gruppen im Dialog miteinander stehen. Ich fand das beeindruckend, wie Sie das im „Europäischen Traum“ in Bezug auf Spanien beschrieben haben. Man muss, so möchte ich es mal übersetzen, auch den richtigen Rhythmus, die richtige Tonalität für das Gelingen einer Diskussion zulassen. Dieser Gedanke Ihres Buches betört mich: Es gilt, darüber zu sprechen, dass eine gelingende Erinnerungs- und Gedenkkultur quasi heiße und kalte, laute und leise Phasen kennt – Phasen des Sprechens und Phasen des Schweigens – , dass diese sich sogar abwechseln müssen, dass sonst unterschiedliche Gruppen nicht offen und vorurteilsfrei miteinander reden können, weil die Konflikte zwischen ihnen sonst zu groß würden. Und das ist ja für uns hier gerade ein extrem aktuelles Thema. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung erscheint um uns herum eine große Unversöhnlichkeit. Aber ich springe jetzt zu sehr.
ALEIDA ASSMANN: Überhaupt nicht, bitte weiter.
JONAS ZIPF: Wenn wir über Teilhabe sprechen, dann reden wir heute über eine der schwierigsten Situationen, gerade hier in Thüringen, die wir mit Corona fast schon vergessen zu haben scheinen. Aber nach der Staatskrise ist vor der Staatskrise; die Thüringer Wahl ist um ein Jahr aufgeschoben, aber nicht aufgehoben; eine strukturelle Mehrheit gibt es hier nicht. Und wir wissen eigentlich nicht genau, wie es gehen kann mit einer CDU, die sich zwischen einer Linkspartei, mit der sie nicht kooperieren will und einer AfD, mit der sie nicht kooperieren darf, aufreiben lässt. Das ist eine sehr angespannte Situation, die viele Parallelen zu der Zeit von Rosenthal aufweist. Dessen Überzeugungen, seine Form von Teilhabe, von Sprechfähigkeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, wäre auch heute das Alpha und Omega der Demokratie, aber sie scheint nicht mehr ausreichend Vielen gleich wichtig zu sein.
ALEIDA ASSMANN: Ich möchte hier gerne ein paar Punkte nochmal unterstreichen. Also, dass Sie das Wort Rhythmus benutzt haben, finde ich interessant, denn solche Prozesse, die lange schwelen, ja, die haben in der Tat auf irgendeine Art eine zeitliche Ausdehnung, und diese hat vielleicht auch eine Gestalt, einen Takt und vielleicht sogar eine Art von Rhythmus. Der hat etwas zu tun mit dem Druck der Emotionen, die bestehen bleiben und die vielleicht irgendwann immer heißer werden. Und dann muss es einen Katalysator geben, der das herauslässt. Und im Falle des Spanischen Bürgerkriegs war das eindeutig die dritte Generation. Sehr oft sind es dritte Generationen, die darüber entscheiden, was wir noch aufgreifen oder was wir weiterhin zurückstellen. In Spanien war es ganz ausgesprochen die zweite Generation nach dem Bürgerkrieg, die gesagt hat: „Wir lassen das ruhen, uns ist die Demokratie wichtiger, und die Aufarbeitung, die kann noch warten.“ Und dann kommt die nächste Generation und sagt: „Nein, unsere Großväter, die wollen wir suchen, die liegen in Massengräbern verscharrt, die exhumieren wir, und die bestatten wir pietätvoll und würdig.“ Da gibt es plötzlich ein Dringlichkeitsbedürfnis. Und ich würde sagen, so etwas Ähnliches ist im Moment auch in den USA zu spüren. Da ist etwas ganz, ganz lange am Schwelen, und dann kommt ein Ereignis und gibt diesem Moment eine historische Dimension, verwandelt ihn in so etwas wie ein Momentum, verleiht ihm eine besondere Bedeutung, eine Relevanz. Plötzlich entsteht etwas ganz anderes als eine passive Joint Attention, so wie wir es gewohnt sind bei einem Medienereignis. Plötzlich ist da so etwas wie ein Lauffeuer, das sich in Windeseile überall verbreitet, das eine Jede und einen Jeden – auf unterschiedliche Weise – erfasst, so dass sich Jede und Jeder irgendwie damit auseinandersetzen muss. Und dieser Druck, der sich da ganz plötzlich verdichtet, um Dinge aus der Vergangenheit wieder anzusprechen, von denen man gedacht hatte, man hätte sie so gründlich verdeckt oder so gut abgedichtet, dass man ewig Ruhe hätte, macht in einem historischen Moment mit einem Mal deutlich, dass die Zeit reif ist, um bestimmte Fragen neu zu klären. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass es solche Wendeereignisse gibt. In Spanien war das um 2000 der Fall, aber es ist wieder abgeebbt und abgeflaut. Aber dann kam ein nächster Schub und plötzlich war klar, Franco muss umgebettet werden. Das sind völlig unvorhersehbare Ereignisse, die nicht einzelne Personen entscheiden, sondern die von so einem Rhythmus der Emotionen abhängen.
JONAS ZIPF: Uwe Johnson spricht als Schriftsteller davon, dass er schwanger geht und dass er manchmal schwanger ist, ohne es zu wissen. Diese Metapher beschreibt, so wie Sie gerade, ein Wechselspiel zwischen unbewussten und bewussten Vorgängen, unbenommen, dass diese Begrifflichkeit nicht ohne Weiteres 1:1 auf gesellschaftliche Kollektive übertragbar ist. Aber dennoch gibt es offensichtlich vergleichbare Prozesse, die im Hintergrund arbeiten müssen, bevor eine Erkenntnis reif scheint. Das ist wie beim Lernen. Es gibt eine Phase des bewussten schnellen Lernens, würden Hirnforscher mittlerweile gut belegen können, dann gibt es eine lange Phase der Durststrecke, wo etwas sickern muss, und irgendwann bricht es sich dann Bahn.
ALEIDA ASSMANN: Ja, ja.
JONAS ZIPF: Der Vergleich mit der aktuellen amerikanischen Situation scheint mir treffend. Plötzlich ist eine Situation ganz offen, und die Frage ist, was wird aus dieser sehr offenen Situation. In Bezug auf unsere Situation heute frage ich mich freilich, ob die wirklich so offen ist. Wir hatten ja ganz am Anfang festgestellt, dass im Moment vielleicht langsam die Rechnungen aufgemacht werden, die diese Gemeinschaft miteinander ausficht. Ich habe das an anderer Stelle in diesen Gesprächen schon mal gesagt, mich erinnert das ein bisschen an die 2015er-Situation, dieser Vergleich wird gerade oft gezogen. Es passiert ein Zeitraum des gemeinsamen solidarischen Ärmelhochkrempelns, und danach kommt der Zeitraum der großen Abrechnung, und ich frage mich, ob diese Gemeinschaft diese Zerreißprobe meistert. Wir sind jetzt an einem Kipppunkt.
ALEIDA ASSMANN: Ich sehe es ein bisschen anders als 2015. Nur fünf Jahre später stehen wir schon wieder an so einem Punkt der, um es mit Johnson zu sagen, schwanger geht mit einer Wende. Was ich 2015 anders gesehen habe, war, dass es nicht erst die Willkommenskultur gab, und dann kam die Ablehnung, sondern beides gab und gibt es gleichzeitig. Die Frage stellt sich an die medial vermittelte Aufmerksamkeit: Wann wird was in den Mittelpunkt gestellt? Am Anfang erschien es viel wichtiger und spektakulärer, die Willkommenskultur zu präsentieren und damit stark zu machen. Und dann, nachdem Hunderte und Tausende ehrenamtlich in ihrem Alltag arbeiteten, um das alles zu bewältigen, war das überhaupt kein Medienthema mehr, das wollte keiner mehr wissen. Viel interessanter waren plötzlich die, die sich ganz empört gegen die Willkommenskultur wendeten. Wir bekommen manchmal eben erst eine Seite gezeigt und dann die andere, müssen aber selber stets mit hinzudenken, dass es das andere weiterhin parallel gibt. Das ist mir sehr wichtig in Bezug auf unsere europäischen Nachbarn. Wie geht es zu in diesen Ländern, in den dortigen Gesellschaften? Da kriegen wir meistens die negativen Seiten gezeigt, und diese werden damit auch unterstützt, weil denen sehr viel Raum gegeben wird, beispielsweise den antidemokratischen Bewegungen in Osteuropa, von denen wir aber letztlich meist überhaupt nur die jeweiligen Präsidenten zu hören bekommen. Was in den Gesellschaften wirklich stattfindet, das kriegen wir nicht mit. Denken Sie an ein Ereignis wie die Ermordung des Bürgermeisters Adamowicz in Danzig! Er gehörte zu den Anhängern der EU und war eine Stütze der Zivilgesellschaft. Plötzlich bemerkt man den Rückhalt einer riesigen Masse von Menschen, die eben eine andere Richtung verkörpern. Deswegen ist es für mich immer wichtig zu fragen, wo sind die anderen und wann kriegen wir die wieder zu hören? Und das führt uns ja auch zurück zu der Grundfrage, die Sie gestellt haben, nach dem Diskursraum Europa. Also dieser Diskursraum kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir viel bessere Kanäle haben, um uns über diese Grenzen und auch über diese Engführungen der Medien hinaus gleichmäßig auszutauschen.
JONAS ZIPF: Ja, absolut. Diese unterschiedlichen Strömungen ereignen sich gleichzeitig, werden aber nicht immer gleichermaßen repräsentiert. So gesehen besteht die Frage darin, welche Strömung sich auf dem Weg der medialisierten Öffentlichkeit in einer offenen Situation wie der aktuellen durchzusetzen versteht. Zum Beispiel beeindruckt mich tagesaktuell, dass einerseits die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, wo ja auch Bürgerrechte in Stellung gebracht wurden, nicht so sehr zu verfangen scheinen, nicht so viele Leute mobilisieren konnten, wie andererseits die Antirassismusbewegung in Amerika, die nicht von ungefähr gewaltig auch nach Europa herüberschwappt, denn auch hier gibt es strukturellen Rassismus. Dass der jetzt derart Gegenkräfte zu mobilisieren vermag, das ist für mich auf jeden Fall ein Hoffnungsmoment.
ALEIDA ASSMANN: Genau!
JONAS ZIPF: Und das ist übrigens auch wieder ein multilaterales Zeichen. Schließlich verlaufen die Trennlinien der gruppenbezogenen Menschendiskriminierung längst jenseits der nationalen Grenzen, da geht es ja um internationale Diskurse.
ALEIDA ASSMANN: Ja, und sie verlaufen noch über eine andere Grenze hinweg, die uns bisher sehr stark eingeschränkt hat, und das ist die Grenze der Identitätspolitik. Denken Sie an „Can the Subaltern speak?“ von Gayatri Spivak. Das war so ein schlagender Essay. Daraus galt es doch, die Lehre zu ziehen, dass die Subalternen, im Falle von Spivak die in Indien, eben nicht für sich und ihre Belange sprechen. Sie können und dürfen nicht sprechen. Also sind sie es, die jetzt erst mal für sich selbst sprechen müssen. Daher sollen wir anderen auf keinen Fall für oder gar über sie sprechen. Diese Erkenntnis war wichtig, aber sie führte auch dazu, dass erst mal jede Gruppe nur ihre eigene Gruppe vertreten konnte. Also wenn man irgendetwas tat und man hatte nicht die richtige Hautfarbe, dann war man nicht befugt, denn das war „Cultural Appropriation“ und so weiter. Ich finde, die postkolonialen Diskurse stehen da mittlerweile an einem kritischen Punkt. So richtig die Schritte und Konsequenzen nach Spivak und anderen waren, um den „subalternen“ Gruppen ihre Sprache zurückzugeben, sich selbst darzustellen und ihre Stimme zu erheben, so unglücklich ist es, wenn der postkoloniale Diskurs dort stehen bliebe. Wir sehen doch jetzt, dass es auch sehr wichtig sein kann, für andere zu sprechen, aber eben nicht an ihrer Stelle, sondern mit ihnen. Es ist möglich, das über Identitätsschranken hinweg zu tun. Wir erleben gerade ein wirksames globales, multilaterales Geschehen, das sich über Grenzen ausbreitet. Viele fühlen sich berührt, da Zeichen zu setzen und mitzureden, das ist gelebte Solidarität.
JONAS ZIPF: Das teile ich. Das ist ein Zeichen der Hoffnung. — Damit möchte ich die Brücke schlagen zu einem Thema, das uns in Jena momentan stark beschäftigt. Das ist das Gedenken an die Betroffenen, die Opfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Ich spreche von „sogenannt“, da die Verkürzung auf „NSU“ sonst in meinen Augen wie ein andauernder indirekter Propaganda-Sieg dieser Gruppe wirkt. Natürlich verbindet sich damit das Thema der rechtsextremen Umtriebe in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Gerade die aktuellen Ereignisse rund um die Drohschreiben des sogenannten „NSU 2.0“ zeigen, dass niemand davon ausgehen kann, das alles sei vorbei. Doch lassen Sie uns über die Opfer, die Betroffenen, statt über die Täter*innen sprechen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen die Communities der Betroffenen, mit diesen Gruppen, etwa den postmigrantischen Selbstvertretungen, gilt es zu sprechen, genau wie Sie es sagen, und nicht über sie oder für sie. Das ist eine zentrale Gelingensbedingung für die Anstrengungen und Vorbereitungen, die jetzt hier in Thüringen und in Jena im Moment laufen: 2021 jähren sich zum 20. Mal die ersten Taten dieses NSU-Komplexes, und zum 10. Mal dessen Selbstenttarnung. Wir reden dabei vor allem über die Rolle des Staates. Und das möchte ich kurz reflektieren, bevor wir auf die Inhalte unserer Planungen zu sprechen kommen: Sie und ich, Frau Assmann, wir sind bzw. waren ja beide Staatsbedienstete, in unterschiedlichen Funktionen zwar, arbeiten aber beide, ob Hochschule oder künstlerische Institution, unter dem schützenden Vorzeichen der Unabhängigkeit. Die vielleicht wichtigste Ressource unserer staatlichen Institutionen scheint mir die verfassungsseitig garantierte wissenschaftliche, respektive künstlerische Freiheit. Wie aber können wir unsere Rolle angesichts des massiven Vertrauensverlusts, den die vom sogenannten NSU betroffenen Gruppen erlitten haben und noch erleiden, produktiv einbringen? Meine Frage lautet – und bei dem anstehenden, anspruchsvollen Projekt geht mir das gerade ziemlich nahe – Wie sehr eignet sich der Staat als Moderator für einen solchen Prozess des Diskurses der Gedenkkultur? Rund um den sogenannten NSU waren es zivilgesellschaftliche Gruppen, die den Diskurs in Gang gebracht haben und auch am Leben halten, gerade auch hier in den Städten der Täter, in Jena und Zwickau, die sich lange gescheut haben oder diese Themen vielleicht aus Stadtimagegründen eher von sich wegschieben wollten. Aber die zivilgesellschaftlichen Akteure haben das Sprechen und das Gedenken aufrecht und aktiv gehalten. Auch gerade dann, als der Vertrauensverlust in den Staat so richtig manifest wurde, seitdem die juristische und politische Aufarbeitung in den Augen vieler Betroffener nicht befriedigend verläuft. Und jetzt kommen wir als Staatsbedienstete, im Falle meiner Arbeitgeber und Förderer ja sogar als Staatsrepräsentanten auf der Landesebene, die aktuelle Landesregierung unter der Führung von Bodo Ramelow, und hier in Jena ein FDP-Oberbürgermeister – wir kommen also jetzt daher und kündigen an, dass wir für das nächste Jahr ein Gedenkprojekt auf den Weg bringen und beanspruchen eine gedenkpolitische, und damit für den Staat wenigstens eine moderierende Rolle. Selbstkritisch betrachtet, müssen wir uns doch möglichst weit zurücknehmen, oder? Andererseits frage ich mich, wer, wenn nicht der Staat, kann am Ende des Tages moderieren? Natürlich muss der Impuls aus der Gesellschaft herauskommen und auch weiterhin in der Gesellschaft stattfinden, aber die Vertrauensfrage in diesen Staat, das ist auch sinnbildlich nochmal gesprochen in Bezug auf Corona, ist, glaube ich, absolut zentral an dieser Stelle. Nochmal: Ich frage mich das als inhaltlich und politisch unabhängiger, durch den Paragraf 5 des Grundgesetzes geschützter staatlich finanzierter Akteur, als der kommunal für Kultur-Verantwortliche, und ich betrachte mich immer eher als solchen, denn als Kulturverwalter, genauso wie die beteiligten wissenschaftlichen Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten. Sind wir vom Verdacht frei, gegenüber den Betroffenen insbesondere, aber auch gegenüber anderen Teilen der Gesellschaft, die man ja zusammenbekommen muss, wenn man überhaupt noch einen gelingenden gedenkkulturellen Diskurs hier hinbekommen will? Können Sie mich da vielleicht auch noch hoffnungsvoller stimmen? Das ist Ihnen jetzt schon zweimal gelungen…
ALEIDA ASSMANN: Mal schauen, wie es weiter geht. Auf alle Fälle betreten wir jetzt genau eine Domäne, von der ich Ihnen kurz erzählen muss. Wir haben am 5. März, das war die letzte öffentliche Veranstaltung an der Uni vor Corona, mit einer Stiftung den Start eines Projekt gefeiert, das den Titel „Gemeinsinn“ trägt: was ihn gefährdet und wie wir ihn befördern können. Wir haben uns vorgenommen, diese Fragen, wie Gemeinsinn entsteht, wie man ihn stützt, was ihn zerstört, auf drei Ebenen anzuschauen: auf der Ebene des Staates oder der Nation, auf der Ebene der Stadt und auf der Ebene des Klassenzimmers. Was die Ebene der Stadt anbelangt, da können wir bereits ein anderes Forschungsprojekt einbringen: „Memory in the City“ mit vier Postdocs, die darüber forschen, wie in der Stadt Gedächtnis produziert wird, gerade auch unter den Voraussetzungen einer Einwanderungsgesellschaft, in der viele Menschen zusammenkommen, die andere Schlüsselerfahrungen mitbringen. Wie wird also ein Gemeinsames ausgehandelt, was steht dem im Wege? Oder, anders gefragt: wird gemeinsam auf eine eben auch traumatische Vergangenheit in der Stadt zurückgegriffen? Jena wäre da ein fantastisches Studienprojekt, und dass Sie da eine so große Rolle oder Verantwortung übernehmen, das finde ich ganz großartig. In meinem Buch über das Unbehagen an der Erinnerungskultur, das 2013 erschienen ist, darin gibt es ein Kapitel über den nationalsozialistischen Untergrund. Es ist überschrieben mit den Worten „Der Schock des 4. November 2011“. Ich spreche davon, dass der 4. November 2011 ein Meilenstein der deutschen Erinnerungskultur ist, von dem aus sich unser ganzes Erinnern und Gedenken anders, neu organisiert. Ich ging ganz selbstverständlich davon aus, dass das nun Folgen zeitigen würde, nicht nur auf der Ebene der Stadt, sondern auch auf der Ebene des Staates. Im Rückblick war das eine völlige Fehleinschätzung. Niemand erinnert sich mehr an diesen 4. November. Immerhin gab es eine staatliche Gedenkveranstaltung, und es gab auch eine Einladung beim Bundespräsidenten. Die Opfer wurden eingeladen, und Joachim Gauck hat da einen ganz wichtigen Satz gesagt: „Sie alle haben erlebt, wie sich von einem Tag auf den anderen das ganze Leben verändert. Sie hätten Trost und Unterstützung gebraucht. Stattdessen sind Sie verdächtigt, gedemütigt und allein gelassen worden.“ Er sprach auch von einer zweiten Traumatisierung, das fand ich sehr beeindruckend, das waren die richtigen Worte in diesem Moment. Aber von einem Meilenstein der Erinnerungskultur kann wirklich nicht die Rede sein.
Ende letzten Jahres wurde ich nach Zwickau eingeladen, nachdem dort ein Baum, den eine Bürgerinitiative als Denkmal gepflanzt hatte, abgesägt worden war und Angela Merkel ein neues Denkmal eingeweiht hatte. Da hatte ich Gelegenheit, in einer Schule sehr ausführlich mit Menschen verschiedener Generationen – Lehrern, Schülern, aber auch Eltern und Großeltern – zu sprechen. Und das war eine sehr gute Erfahrung, die mir zeigte, wie groß die Bereitschaft in diesen Städten ist, Verantwortung in dieser Sache zu übernehmen und wie stark der Gemein-Sinn dort ist. Das ist eine Seite. Die Perspektive der Opfer-Familien hat mir Esther Ditschereit aufgeschlossen, die ich über dieses Thema kennengelernt habe, und von der ich viel gelernt habe. Sie hat mir deutlich gemacht, wie schwierig und heikel es für die Betroffenen ist, dass Denkmäler errichtet werden, weil es jedes Mal für sie nicht nur eine Form der Retraumatisierung ist, sondern auch die Angst erneut entsteht, dass sie wieder irgendwie in den Fokus geraten. Sie fühlen sich immer noch nicht stark genug gestützt und eingebunden, um das wirklich aushalten zu können. Das war für mich eine wichtige Information. Beide Perspektiven sind hier wichtig, die der Stadtbewohner und die der Betroffenen. Und: Ja, es braucht dafür diskursive Plattformen, die ein Akteur auf die Beine stellen muss. Kunst und Kultur sind dafür geeignet, staatlich hin oder her. Deswegen bin ich froh zu hören, dass Sie das mit in die Hand nehmen, und ich werde an diesem Dialog, den Sie da aufbauen, weiter mit Interesse teilnehmen. Denn tatsächlich sind das die Fragen, die jetzt nach 10 und 20 Jahren so aktuell werden: In dieser Phase und bei solchen Projekten zeigt es sich, ob sich die Gesellschaft in Richtung Einwanderungsgesellschaft öffnet oder weiter verschließt. Ob wir Vertrauen und Gemeinsinn in einer offenen Gesellschaft stärken, oder ob es deren Gegnern gelingt, ihren Terror, den sie mit Waffen und Worten ausüben, immer weiter in Richtung Einschüchterung und Erzeugung eines Klimas der Angst und der Bedrohlichkeit zu treiben.
JONAS ZIPF: Wir befinden uns vermutlich an einem Scheideweg. Ich empfinde die Atmosphäre auch gerade innerhalb dieser zugespitzten Krisensituation als äußerst fragil und wackelig, hin und her oszillierend. Ich erlebe nicht wenige Momente, in denen bei den einfachsten Beschwerdevorgängen gegenüber staatlichen Organen Situationen kippen und Umgangsweisen verrohen. Andererseits ereignen sich aber auch regelmäßige Solidaritätsbekundungen und Rückenstärkungen. Letztlich entscheidet sich aber daran, für welche Form der Gesellschaft wir jetzt und künftig stehen und streiten. Ich kann das noch mal an zwei konkreten subjektiven Erfahrungen hier in Jena festmachen: Zwei Erfahrungen rund um das Thema des NSU-Komplexes, die mir Motivation genug sind, dieses Projekt jetzt auf den Weg zu bringen. Als ich 2011 nach Jena kam, als Mitglied der künstlerischen Leitung des Theaterhauses, da entsprach besagter 4. November tatsächlich der Überschrift in Ihrem Buch: die Selbstenttarnung des Terrornetzwerks wirkte wie ein Schock auf die Stadtöffentlichkeit. Das alles, diese Selbstenttarnung von Mundlos und Böhnhardt in Eisenach, dann Zschäpes Reise quer durch Deutschland, die Veröffentlichung der Bekennervideos, das alles fand kurz vor unserer ersten Spielzeiteröffnung in dieser uns neuen Stadt statt. Und dann zeigte das ZDF bei „Aspekte“ einen Beitrag, der das Fass vollends zum Überlaufen brachte: Da kam ein Reporter mit dem ICE nach Jena-Paradies gefahren und lief einmal durch die Stadt und unterhielt sich mit einem türkischen Gastronomen und fuhr wieder weg. Der Beitrag begann mit einer Aufnahme des Bahnhofschilds „Jena-Paradies“, unterlegt von einem Guido-Knopp-artigen Voiceover im Basston: „Jena Paradies, KEIN Paradies für Ausländer“. Ein Teil der Stadtgesellschaft reagierte mit einem reflexhaften Shitstorm der Abwehr. Die Stadtgesellschaft, insbesondere ihr ungewöhnlich hoher akademischer und zivilgesellschaftlicher Anteil, hatte sich in den Nullerjahren in Jena stark gegen Rechts gewendet. Jena war und ist in dieser Hinsicht eine Ausnahmestadt im Osten. Und nun, nach der Selbstenttarnung des soenannten NSU detonierte dennoch mit dem ZDF-Beitrag ein westdeutsches Vorurteil gegenüber den ostdeutschen Städten. Eines, das die Jenenser schon alleine aufgrund des Bildes, das viele Vorbeireisende vom Blick der Autobahn auf das Plattenbauviertel Jena-Lobeda pflegen, kennen, und das sie nicht auf sich sitzen lassen wollten und wollen. Der Shitstorm reichte bis in den ZDF-Rundfunkrat. Leider ging es praktisch sofort nicht mehr um die Frage, wer oder was da aufgeflogen war, welche Verantwortung die Stadtgesellschaft nun schon alleine aufgrund der Herkunft der Terroristen zu tragen hat, sondern um die Verteidigung des Stadtimages. Und diese Verteidigungshaltung hat dann auch die Debatte Jahre danach dominiert, eine Erinnerungs- oder Gedenkkultur fast verunmöglicht, übrigens genauso wie in Zwickau. Beide Städte waren darum bemüht, sich die jeweilige Betitelung des Trios gegenseitig zuzuschanzen. Jena sprach dann immer von der „Zwickauer Zelle“ und Zwickau vom „Jenaer Trio“.
Aber jetzt, nach bald zehn Jahren, und vor allem angesichts der jüngsten Entwicklungen nach Kassel, Halle, Hanau ändert sich langsam etwas. Viele Entscheider, Unternehmer, Politiker und andere Vertreter der Stadtgesellschaft merken einfach, dass man nicht nichts machen kann. Dem vor zehn Jahren bekämpften Vorurteil unterliegen Städte wie Jena spätestens nach den letzten Wahlergebnissen für die AfD sowieso. Plötzlich finden Viele: Auch und gerade aus Stadtimagegründen müssen Zeichen dagegen gesetzt werden. Das hat sich um 180 Grad gedreht. Und ich bin froh darum, weil das in der Summe eine gewisse Einigkeit und eine kritische Masse und einen notwendigen kleinsten gemeinsamen Nenner ergibt, um so ein Projekt durchführen zu können. Aber letztlich geht es um viel mehr, genau wie Sie es gesagt haben, letztlich geht es um den Scheideweg der offenen Gesellschaft. Und damit kommen wir zu meiner zweiten Ur-Erfahrung hier in Jena: 2016 wollte eine Gruppe namens THÜGIDA, eine Art militanter Ableger der sächsischen PEGIDA, durch die Innenstadt marschieren. Sie hat sich natürlich ausgerechnet das gedenkkulturell extrem besetzte Datum des 9. November ausgesucht und die Demonstration tatsächlich genehmigt bekommen. Aber dann marschierten da 80 Teilnehmer, denen sich mehrere Tausend gegenüber stellten. Die Kräfteverhältnisse waren mit einem Schlag klar: THÜGIDA konnte sich nicht durch die Stadt bewegen. Im Jahr darauf gründete sich eine Bürgerinitiative, die fortan Jahr für Jahr immer am selben Tag, immer am 9. November, an allen Stolpersteinen in Jena Demonstrationen anmeldet. Damit verhindert sie nicht nur neuerliche rechte Demonstrationen, sie reklamiert vor allem den 9. November für die mehrheitliche Mitte und stellt deren Gedenken an die Opfer der Reichsprogromnacht in den Mittelpunkt. In Jena existieren knapp 100 Stolpersteine, 100 Exemplare dieses großartigen dezentralen Kunstwerks von Gunter Demnig. Diese Bürgerinitiative liefert nun jedes Jahr und an jedem Stolperstein musikalische Beiträge aus allen Richtungen der Stadtgesellschaft. Überall in der Stadt wird dann Musik gespielt, ein kleines Konzert. Und zu einem gemeinsamen Zeitpunkt, 17 Uhr, läuten die Kirchenglocken, und es wird gemeinsam ein Lied über die ganze Stadt hinweg gespielt und gesungen. Das haben wir jetzt vier Jahre lang gemacht, gemeinsam mit Musikern, auch der Jenaer Philharmonie, und mittlerweile sind an diesem Tag, am 9. November um 17 Uhr, an den Stolpersteinen viele tausend Menschen, sie kommen jedes Jahr wieder. Da ist ein gelebtes Ritual gedenkkultureller Praxis entstanden, und zwar aus der Bürgerschaft heraus.
ALEIDA ASSMANN: Das ist also auch ein regelrechter Schutz diese Stolpersteine…
JONAS ZIPF: Ja. Und vor allem auch eine lebendige Geste des Gedenkens. Ich binde das nochmal zurück. Ganz am Anfang habe ich von „One World, One Voice“ gesprochen, von diesem Projekt, damals an der letzten großen Zeitenwende 1990. Und das ist das, was mir sozusagen die Hoffnung und die Kraft gibt, dass es anders geht und dass die Mehrheiten klar verteilt sind, zumindest in dieser Stadt Jena, weshalb ich auch gerne hier lebe.
ALEIDA ASSMANN: Also das beeindruckt mich ungeheuer, was Sie jetzt sagen. Wie Sie beschreiben, wie die Aktion einer neuen Erinnerungskultur aus der Re-Aktion entsteht, um anderes zu verhindern und dadurch auch eben ein solches neues Momentum bekommt, eine Dringlichkeit, einen Druck, der etwas Neues entstehen lässt. Das finde ich wirklich großartig und das zeigt mal wieder, wie formbar Erinnerung ist und wie sie sich konkreten Situationen anpassen kann. So entstehen in neuen Situationen neue Formen. Und das alles entstand, wie Sie das jetzt schildern, in nur vier Jahren! Das ist wirklich ein eindrückliches Beispiel für die Frage, wie eine Stadt mit ihrer Erinnerung umgeht, die natürlich in einer Stadt immer auch unweigerlich zu einer Imagefrage wird. Dass die Stadtgesellschaft sich potenziell als ein Kollektiv identifiziert, das war uns klar: Deswegen nehmen wir uns auch in unserem Projekt die Städte als kollektive Akteure vor. Da müssen ganz viele Bereiche innerhalb der Stadt zusammenwirken, natürlich die Stadträte und die Funktionäre, aber auch die Geschäfte, der Mittelstand, alle Teile der Bevölkerung, über Generationen hinweg, und die neu Hinzugekommenen – sie alle können sich zu so etwas konkret Greifbarem wie einer Stadtgesellschaft zugehörig fühlen – und das ist in gewisser Weise ein Abbild des ganzen Landes. Jede Stadt könnte eine Blaupause für die Nation sein.
Was mich hier auch noch sehr interessiert, ist die Tatsache, wie wenig die eine Stadt über die andere weiß. Vielleicht wird man in Weimar und in Erfurt noch etwas von dem mitbekommen, was Sie in Jena machen, aber ganz grundsätzlich gilt das für alle deutschen Städte. Die Erinnerung wird in den Städten lokal organisiert durch die Einwohner, die in ihr leben. Es gibt hierüber so gut wie keine Berichterstattung in überlokalen Zeitungen. Das ist auf dieser Ebene kein Thema und deshalb auch unbekannt. Weil ich das seit Jahren untersuche, mich dafür interessiere und in vielen Städten mit lokalen Gruppen darüber diskutiert habe, weiß ich, wie unterschiedlich das überall läuft. Für mich ist das der beste Beweis für die Lebendigkeit der deutschen Erinnerungskultur, an der ja so sehr herumkritisiert wird die ganze Zeit. Alle, die ihr Unbehagen darüber ausdrücken, sehen immer nur den Staat als Auftraggeber, der den monotonen und rituellen Rahmen herstellt für diese Erinnerungskultur. Ich sehe dagegen, wie vielfältig dieser Rahmen gefüllt wird, und zwar von unten. Hier gibt es nämlich keine festen Normen. Da sagt niemand: „Ihr müsst jetzt das und das machen, wir geben euch die und die Dinge vor.“ So hat das auch angefangen in den 1980er Jahren, diese ganze Spurensuche, hier und jetzt, gerade unter unseren, unter deinen Füßen, überall finden wir, findest du die Spuren, die verwischt wurden. Aber sie sind noch da. Dieser Impuls, der da von unten kommt, lokalisiert ist und diese Erinnerungs-Aufarbeitung vor Ort überhaupt erst möglich macht, ist doch wirklich weitgehend in den Händen der Ehrenamtlichen geblieben, die dann zum Beispiel Spuren jüdischen Lebens aufgedeckt haben, so wie Sie das gerade wieder mit Eduard Rosenthal und seiner Frau Clara in Jena machen. Diese Arbeit, die kommt von unten und wird zu einem Teil der Identität der Stadt, die über das Image der vermarkteten Stadt hinausgeht, da sie eben die Geschichte einschließt, die das Selbstbewusstsein einer Stadt stark mitbestimmt. Die Fragen nach dem kollektiven Wir oder besser ausgedrückt: einem neuen Wir, so wie es gerade in der Einwanderungsgesellschaft entsteht, diese Fragen kann man wie im Brennglas in den Stadtgesellschaften entdecken. Was auf der Ebene der Städte passiert, muss auch auf der Ebene der Nation passieren, dann natürlich wieder mit anderen Mitteln. Darüber müsste man dann nochmal genauer nachdenken.
JONAS ZIPF: Ja. Wie sich solche Rituale erst mal über Städte hinweg, dann aber auch über Ländergrenzen hinweg organisieren lassen, das wäre natürlich die konsequente Folgefrage, ganz im Sinne Ihres „Europäischen Traums“, aber dafür wird die Zeit hier und heute nicht mehr reichen. Wir haben ja schon so Vieles besprochen, das der weiteren Vertiefung an anderer Stelle bedarf. Natürlich immer innerhalb eines Wir, da sind wir beide uns sicher einig, was eben aus vielen unterschiedlichen Stimmen besteht und eben sprechfähig und diskursfähig sein muss.
ALEIDA ASSMANN: Ja.
JONAS ZIPF: Darin, daraus besteht unser Versuch, unser Impuls, den wir aus Jena gesetzt haben: Dass wir im nächsten Jahr dann mit einem Höhepunkt im Zeitraum der zweiten Oktoberhälfte 2021, mit 13 Theatern, zugleich alle Städte, die vom sog. NSU betroffen waren oder in denen die Täter gelebt haben, zusammenbringen.
ALEIDA ASSMANN: Das ist der dritte Teil der Trilogie?
JONAS ZIPF: Genau. Der Abschluss des Gesamtprojekts. Am Anfang steht momentan die stadtgesellschaftliche Aufarbeitung und Verständigung. Gemeint als „Hausaufgabe Jenas“, als Kehren vor der eigenen Haustür, bevor man sich im Prinzip auf den Weg macht. Das Projekt besteht dann aus mehreren künstlerischen Beiträgen, die über die 13 beteiligten Städte und Theater hinweg entstehen: Das ist zum einen die künstlerische Übersetzung der juristischen Aufarbeitung der Taten durch den Regisseur Nuran David Calis, zum zweiten eine in allen Städten zeitgleich erklingende Auftragskomposition von Marc Sinan, zum dritten ein dezentrales Denkmal, das seinen Ausgangspunkt in Jena nimmt und in den Folgejahren in den anderen Städten erweiterbar wäre. Das Alles denken wir in einer starken zivilgesellschaftlichen und überregionalen Signalhaftigkeit, deren Grundlage ein seit mehreren Monaten laufender, tatsächlich sehr spannender Erfahrungsaustausch zwischen den Theatern und den Stadtgesellschaften bildet, die einfach in sehr unterschiedlicher Form mit dem Thema umgehen. Da gibt es so extrem aktive Beispiele wie Köln, wo sich das NSU-Tribunal letztlich ja gegründet hat. Und dann gibt es Städte, wie Zwickau, ja, das wäre vielleicht wirklich ein Beispiel am anderen Ende des Spektrums, wo man merkt, dass die AfD schon ihren kalten kulturpolitischen Hauch bis in die Spielplangestaltung hineinwehen lässt, wo sich die Stadtverwaltung auch wirklich schon eine blutige Nase geholt hat. Sie haben es ja vorher auch angedeutet mit ihrem unangesprochenen, nennen wir es mal: „Alleingang der Bäume“. Aber spannend wird das eben, dass diese unterschiedlichen Vertreter der Städte jetzt zusammenkommen.
ALEIDA ASSMANN: Ja, das ist es: Raus aus diesen ständigen Alleingängen.
JONAS ZIPF: Erst mal ist es gar nicht so entscheidend, wie das Produkt, das Ergebnis, am Ende aussieht, sondern viel wichtiger ist der Prozess der Verständigung und des Erfahrungsaustausches über die Stadtgrenzen hinweg. Darin besteht unser Anliegen, unsere Verantwortung als Stadt, aus der die Täter*innen stammen.
ALEIDA ASSMANN: Die Zusammenführung der Städte, wie Sie sie planen ist so originell und beeindruckend. Es gibt diese Blutspur durch alle diese Städte, und manche sind zweifach betroffen. Dass diese Spur freigelegt wird und in ein positives Zeichen umgeformt wird, das wäre so eine erste Solidarisierungsallianz, die natürlich auch über Ost und West hinweggeht und vielleicht auch eine Bühne wird, eine Art Szene, in der man genau diese Fragen auch neu wieder stellen kann. Und zwar auf der höheren Ebene, die Ebene der Nation als Frage nach so etwas wie einem gemeinsamen Narrativ. Das meine ich nicht einengend oder von oben verordnend, was gar nicht funktionieren kann, aber ich meine es von unten kommend, so im Sinne des Sich-Austauschens über unsere eigene Geschichte, dialogisch, so wie wir das in unserem Gespräch jetzt herausgearbeitet haben. Eine Frage zu diesem Narrativ, die mich derzeit beschäftigt, lautet: Wie kann man die letzten 30 Jahre, seit der Wende, anders erzählen, so dass diese Zeit zu einer gemeinsamen Geschichte wird, dass wir aus dieser Zeit heraus in eine gemeinsame Zukunft gehen können? Da scheint mir nämlich eine Blockade in unserer Geschichte zu liegen, ein richtiger Block, der in so einem überregionalen Austausch zwischen den Städten aufgenommen werden könnte. Daher möchte ich Ihnen danken, für diesen Anlauf. Das sind doch gute Aussichten, ja.
JONAS ZIPF: Nein. Bei so viel Zustimmung muss ich ganz zum Ende wenigstens ein einziges Mal widersprechen: Nein, ich habe zu danken, Frau Assmann, für das wirklich sehr anregende Gespräch. Danke Ihnen!
ALEIDA ASSMANN: Ganz meinerseits. Also dann weiter alles Gute für alle diese großartigen Sachen, die Sie da vor sich haben. Ich werde jetzt erstmal einen Spaziergang machen, da werde ich meinem Mann alles erzählen, was wir gerade besprochen haben.
JONAS ZIPF: Grüßen Sie ihn unbekannterweise von mir.
ALEIDA ASSMANN: Ja, mache ich, mache ich.
JONAS ZIPF: Bis bald.
Und wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, auch die vorherigen Corona-Gespräche nachlesen möchten, können Sie hier im Blog einen Osterspaziergang mit Hartmut Rosa, Gedankenspiele mit Thomas Oberender und Sinuskurven mit Bernhard Maaz mitverfolgen.
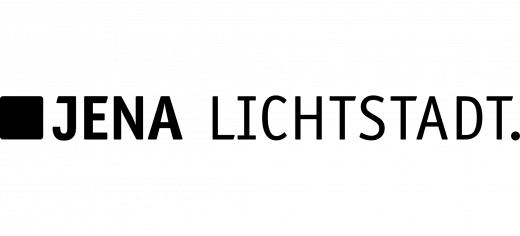

Ein sehr inspirierendes Gespräch. Danke
Vielen Dank für Ihr Feedback, das freut uns sehr!