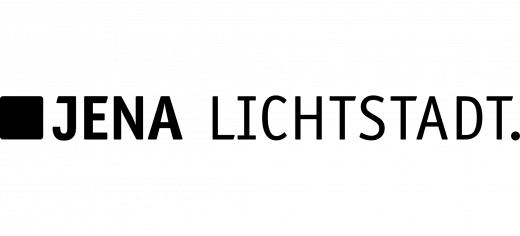Gedanken zum Tag der Arbeit
Thomas Oberender stammt aus Jena. Der heutige Intendant der Berliner Festspiele zeigt sich im Gespräch mit Jonas zipf nachdenklich. Und offen für Gedankenspiele. Wie entwickeln sich Kunst und Kultur nach der Corona-Krise? Denn beide Kulturverantwortliche finden: Im Moment der Krise kommt es darauf an, den Kern der eigenen Arbeit zu hinterfragen und möglicherweise neu zu definieren. Im Mittelpunkt ihres Telefonats stehen Fragen nach der Balance zwischen Kunst und Institution, zwischen der Kunst des Anthropozäns und unserem Verhältnis zur Natur. Sowie – passend zum Tag der Arbeit – die Erinnerung an einen Vorschlag, der unsere Auffassung von Arbeit revolutionieren würde…
Ein Telefonat
JONAS zipf: Zum Einstieg muss ich erst mal das letzte Gespräch aus den Kleidern schütteln. Ich stecke hier zwischen zwei Kriseninterventionen. Gerade ging es um die prekäre Situation von Honorarkräften in der Jenaer Musik- und Kunstschule. Es entstehen gerade einfach so viele Unwägbarkeiten. Daher stelle ich eine einfache W-Frage zum Einstieg. Wie kann ich mir die Konstruktion Eurer Institution in Berlin vorstellen? Ist das – pejorativ gesprochen – auch so ein Gemischtwarenladen wie JenaKultur?
THOMAS OBERENDER: Unsere Institution ist in der Tat ein Hybrid. Wir sind Teil einer GmbH-Struktur, die sich „Kulturbetriebe des Bundes“ nennt, und damit eine der wenigen kulturellen Einrichtungen, die der Bund als Institutionen selbst unterhält und nicht nur bezuschusst. Unsere Gesellschaft hat drei unterschiedliche Geschäftsbereiche. Die Berlinale gehört dazu, das Haus der Kulturen der Welt und die Berliner Festspiele. Und wir unterhalten drei Immobilien, die durch uns ganzjährig bespielt werden: Das Haus der Kulturen der Welt, den Gropiusbau und das Haus der Berliner Festspiele. Während früher die Festspiele zur Hälfte vom Bundesland und zur Hälfte von der Bundesregierung finanziert wurden, sind wir seit 2003 zu hundert Prozent bundesgefördert. Vor zwanzig Jahren verfügten die Kulturbetriebe des Bundes über ein Budget von zwanzig Millionen Euro, inzwischen setzen wir mehr als sechzig Millionen um. So entstehen mittlerweile wesentlich höhere Verwaltungskosten, aber die zentrale Verwaltung aller Geschäftsbereiche spart auch Kosten. Inhaltlich prägen uns sowohl zyklische als auch jahresdurchgängige Programme. Zyklisch sind alle Festivals, das Jazz-Fest, das Musikfest, MaerzMusik und das Theatertreffen; zyklisch sind genauso aber auch die Bundeswettbewerbe, mit denen wir für junge Künstler im Bereich Literatur, Musik, Tanz und Theater eigene Akademieprogramme realisieren. Und das ganze Jahr hindurch laufen Ausstellungen oder auch unsere interdisziplinäre Programmreihe „Immersion“, in der wir sowohl Ausstellungen als auch Theaterproduktionen, Konferenzen oder Kunstfilme für Planetarien produzieren. So kann man sich unsere Arbeitsweise vorstellen. Die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schwankt, weil während der Festivals sehr viel mehr für uns arbeiten als im Rest des Jahres. Die Basis für alles sind unsere hoch spezialisierten Festangestellten in den Querschnittsabteilungen, die sich z. B. das ganze Jahr um Kommunikation kümmern oder den Bereich Technik.
JONAS zipf: Die Idee von unterstützenden Querschnittsabteilungen ist ja auch eine Grundlage der Konstruktion von JenaKultur. Bei uns besteht ein Mehrwert darin, dass praktisch die Kulturpolitik, seitens der Stadt vor allem, aber auch seitens des Landes, einen Ansprechpartner für die gesamte Kultur der Stadt Jena hat, und einen Vertrag verhandelt, der alle bezuschussten Leistungen enthält – alle Einrichtungen und Bereiche der Jenaer Kultur, von kultureller Bildung bis zur Hochkultur – und dann übrigens für vier Jahre gilt. Und innerhalb dieser vier Jahre entsteht im Umgang mit den Mitteln so etwas wie eine unternehmerische Freiheit. JenaKultur ist ein Kulturunternehmen, aber nicht in Form einer GmbH, sondern eines Eigenbetriebs. Dadurch besteht der Mehrwert nicht nur in organisationsstrukturellen Synergien, sondern auch in inhaltlichen Querverbindungen, zum Beispiel im Rahmen von Themenjahren.
THOMAS OBERENDER: Ja, das klingt toll.
JONAS zipf: Natürlich alles auf einem anderen Niveau, im Vergleich zu den Ansprüchen, die natürlich eine Bundesunternehmung wie eure in der Hauptstadt mit sich bringt. Aber die Fragen an solche Konstrukte sind strukturell vergleichbar: Sind solche Modelle im weitesten Sinne zukunftsfähig, und welche Vorteile bieten sie im Verhältnis von Breite zur Spitze? Ist das Hybride zwischen verschiedenen Genres und auch institutionellen Kunst-Traditionen, zwischen Festival-Highlights und alltäglicher Arbeit möglicherweise zukunftsfähiger als die klassische Vereinzelung der Häuser? Im Moment der aktuellen Krise stehen diese Fragen doch offen vor uns. Was lernen wir als Verantwortliche von solchen Kulturbetrieben für die Zeit danach? Dahinter erscheint für mich eine sehr grundsätzliche Fragestellung nach dem Verhältnis zwischen Festangestellten und Freelancern. Das sieht man etwa an dem Konflikt, den ich heute in der Musik- und Kunstschule erlebe. Einerseits versuchen wir gerade, für die anstehenden Verteilungsdiskussionen vorzubauen und beantragen Kurzarbeit. Präsenzunterricht ist nicht möglich, Online-Unterricht ist über die Entgeltordnung nicht abgedeckt. Somit brechen uns die Einnahmen weg. Und in dem Moment, an dem wir die Festangestellten in Kurzarbeit schicken, können wir natürlich andererseits die Honorarkräfte nicht weiterbeschäftigen und -bezahlen. Das riecht ja geradezu nach Scheinselbstständigkeit. Das führte im Bereich der Musikschule zu einer Petition, dann zu einem regelrechten Shitstorm, weil praktisch fünfzig Prozent aller Leistungen, die wir ermöglichen, über Honorarkräfte laufen. Was zu der Frage führt: Wie viel Freelancertum ist gut für Kunst und kulturelle Bildung? Wir beide können uns jetzt natürlich in diesem Telefonat problemlos unendlich viele feste Stellen wünschen und ausdenken, aber bei der Musikschule würde das konkret heißen: Wenn ich die Stellenzahl der Festangestellten erhöhe, muss ich bei gleichbleibender Bezuschussung die Menge der Angebote reduzieren. Und ist das im Moment nicht die Denkrichtung, die wir brauchen? Im Sinne von: „Less is more“? Gerade, wenn ich auf den Theaterbereich mit der engen Taktung der Premieren schaue, frage ich mich, ob wir nicht für dasselbe Geld festere, verbindlichere Verhältnisse der Arbeit im Hintergrund haben könnten…
THOMAS OBERENDER: Also ein Statement hat das Corona-Virus wirklich zum Verschwinden gebracht: „Ich arbeite gerne frei.“ Bis vor kurzem gab es viele Leute, die tatsächlich keine Stelle wollten, weil sie die Fremdbestimmung durch die Strukturen und Fristen großer Betriebe für sich nicht produktiv gefunden haben. In prosperierenden Zeiten bevorzugten sie ein frei organisiertes Arbeitsleben, das sie von Projekt zu Projekt mehr oder weniger verlässlich finanziert hat. Und diese Beweglichkeit, aber auch Eigenbestimmtheit war ja für viele Menschen etwas, was sie als große Qualität empfunden haben. Jetzt, in dem Moment, in dem der Markt der künstlerisch Freischaffenden zusammenbricht, ist jeder, der eine feste Stelle hat, heilfroh. Ich auch, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist eben auch der Moment, da wir darüber nachdenken sollten, wie die strukturelle Ungerechtigkeit, die den kulturellen Bereich prägt, in Zukunft abgebaut wird. Kurz vorm Tag der Arbeit müssen wir uns fragen, wie Arbeit gerechter verteilt und gesichert werden kann. Die Mittel im kulturellen Bereich gehen zu mehr als zwei Drittel in den institutionellen Bereich und nur sehr wenig in den Projektbereich, der die Risiken alleine schultert, aber immer als „nice to have“ behandelt wird, als ein gewisses „Extra“, während die „richtige“ Kultur in den alten Strukturen wohnt. Aber das ist längst nicht mehr so. Uns treiben daher seit langem Überlegungen um, wie man unsere Institutionen umformen müsste. Es gab in den letzten Jahren eine schleichende Politik, von der ich denke, dass sie „Institutionen neuen Typs“ geschaffen hat. So nenne ich Institutionen, die eigentlich nur noch Hüllen sind. Sprich: Konzerthäuser ohne eigenes Orchester, Ausstellungshäuser ohne eigene Sammlung, Theaterhäuser ohne eigenes Ensemble. In den Niederlanden oder Belgien würde das Theaterhaus Jena keine eigene Kompanie haben, sondern lediglich eine Spielstätte für freie Theater- oder Tanzkompanien sein, ein Gastspielhaus. In den Niederlanden bekommen die Ensembles das Geld, nicht die Häuser. Aus dieser Struktur kommt eine niederländische Gruppe wie „Wunderbaum“. Ohne solche Kompanien würde das Benelux-System nicht funktionieren. Und auch in Deutschland leben immer mehr Häuser und Festivals davon, dass es eine professionelle freie Szene gibt, die innovativ und sozial engagiert produziert. Zu dieser Szene zählen auch Kuratoren, Ausstellungsmacher und andere Freelancer, die das ökonomische Risiko auf sich nehmen, um künstlerisch konsequenter und oft auch spartenübergreifender zu arbeiten. In den letzten Jahren entstand also parallel zu den klassischen Stadttheater- und Orchesterstrukturen ein oft international vernetztes Produktionssegment, das stark um seine Anerkennung kämpfen muss und von der Krise jetzt viel härter getroffen wird. Wie soll man bloß diese zwei Märkte oder Produktionswelten, die nie mehr verschwinden werden, versöhnen? Sie haben das am Beispiel der Jenaer Musikschule ja eben beschrieben. Soll man dort perspektivisch überhaupt keine eigenen Lehrer mehr fest anstellen, sondern einen riesigen Pool temporär beschäftigter Lehrkräfte bilden, die alle noch weitere Jobs zum Leben brauchen, aber die Institution weniger kosten? So verschieben wir das Risiko und die Härten in Richtung der Freiberufler und können an den Häusern vielleicht ein paar mehr Angebote machen, aber das hat seinen Preis. Das ist das Modell der Institutionen neuen Typs, wie ich sie nenne, und das ist die eigentliche Tendenz der Kulturpolitik der letzten zwanzig Jahren. Auf der anderen Seite sind aber auch bei den staatlichen Häusern kaum mehr feste Stellen hinzugekommen und die Budgets halten mit den Tarifsteigerungen oft gerade so mit, ohne neue Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. So entstehen in klassischen Institutionen Innovationen heute oft ebenfalls nur durch Projektmittel, die auf Antrag und auf Zeit vergeben werden. Das heißt, die institutionell geförderten Einrichtungen sind in den letzten Jahren ebenfalls in Richtung Prekarisierung entwickelt worden. Ich glaube, man muss sich über, ja, dieses System, das eigentlich ein Schattensystem ist und keine wirklich offizielle Anerkennung oder Abbildung in den Debatten findet, viel ehrlicher unterhalten.
JONAS zipf: Aber was erstaunlich ist, ist ja, dass das schon so ein halber Paradigmenwechsel ist. Sie haben gesagt, all die Freien, die Prekarisierten, die haben sich lange Zeit auch aus ideologischen Gründen dieser Sache verschrieben. Es ging nicht nur darum nicht irgendwo abhängig beschäftigt zu sein, sondern auch nicht im Auftrag des Staates zu arbeiten, nicht mal angebunden an den Staat. Das ragt ja noch rüber aus dem alten Verständnis von „Freier Szene“. Mittlerweile ist es längst salonfähig, dass dieselben Akteure eine staatliche Bezuschussung bekomme. Dazu kommen in der Krise jetzt Stimmen, die sagen: Wäre eigentlich schon gut, wenn ich festangestellt wäre. Lange ging die Nichtverstetigung der Anerkennung ja noch wunderbar einher mit der alten Ideologie von „frei sein“. Philosophisch könnte man sagen: Was Deleuze & Co gedacht haben, das ist einfach mit dem Kapitalismus der heutigen Prägung sehr gut vereinbar. Zuletzt wurden ja sogar entsprechende Begriffe, etwa die mittlerweile allseits beliebte „Agilität“, konkret auf Kreativarbeit bezogen. Das wäre eigentlich der Punkt, an dem „die Kreativen“ die Gesellschaft befragen müssten: Was sind wir euch wert? Und dann müssten wir in Bezug auf die institutionelle Betriebsform darüber nachdenken: In was für einer formalen Verabredung soll das zukünftig stattfinden? Vielleicht brauchen wir dann eben nicht mehr die genuin genrebezogene Konstruktion. Vielleicht liegt genau bei ihr der Hase im Pfeffer – zumindest solange die sehr konventionelle Erwartung an ein Theaterhaus besteht, dass es einfach nur Theater produziert und keine Konzerte oder Debatten, oder an ein Museum, dass es nur Ausstellungen produziert und keine Kunstfilmreihen oder Labs. Bei dem höheren wirtschaftlichen Druck, der entsteht, wird es für all die Produzenten zwischen den klassischen Genres nun relativ schwer, zu institutioneller Anerkennung und festen Arbeitsverhältnissen zu kommen. Man denke einfach nur an die großen Bühnen, die in deutschen Städten stehen und tausend Plätze und mehr haben und aufgrund der Einnahmeerwartung jeden zweiten Abend gefüllt werden müssen. Das dämpft die Experimentierfreude und präferiert vielleicht eher 08/15-Lösungen, die vermeintlich den Saal füllen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Häuser vielleicht gar keine eigenen Ensembles mehr haben, dann ist der Schritt in Richtung Prekarisierung der freien, oft eben auch experimentellen Künstler natürlich überhaupt nicht mehr groß, weil die großen, teuren Häuser strukturell gerne konservativer agieren. Wenn ich die klassischen Festensembles auflöse, verliere ich ihre gründliche, dauerhafte und qualitativ exquisite Arbeit – aber Gleiches droht auch den freien Ensembles, die ja oft noch sehr viel stärker einer speziellen Idee verpflichtet sind. Was dann noch bleibt, sind vor allem die kommerziellen Akteure. Denn bei denen kann ich mir weniger riskante Ware im Tourneebetrieb einkaufen. So etwas wie ein Repertoire würde es am Stadttheater nicht mehr geben und sicher auch nicht mehr das Theater einer Stadt, das Stadt-Theater im gewohnten Sinne. Also will sagen: Am Ende ist es für mich vor allem eine Frage danach, ob Kulturinstitutionen sich eben auch übergreifend transdisziplinär erfinden und organisieren müssen. Das bedeutet, dass der gesamte Bereich von Kultur in einer Stadt oder einem Land – ähnlich wie bei einer Hochschule, die auch mehrere Disziplinen unter einem Dach vereint – an einer solchen Kulturinstitution durch einen Gesamtzuschuss finanziert wird, weil sie zukünftig ihrer Natur nach Bereiche vereint, die alle bislang nicht aus sich selbst heraus leben können. Die Politik aber würde die Frage der Verteilung der Mittel – übrigens auch die Frage, ob an feste oder freie Kräfte – in einer solchen Institution über die Genregrenzen hinweg den Experten überlassen. Genau wie bei einem Unipräsidenten. Das wäre so eine Art grundgesellschaftlicher Vertrag, eben nicht, indem quasi jede Institution für ihr je eigenes Recht vor dem fachlandschaftlichen Horizont streiten muss. Dagegen sind wir als Kulturverantwortliche momentan längst selbst viel zu kennziffernorientiert, zu leistungsaffin.
THOMAS OBERENDER: In Berlin gab es genau so ein Konzept. Da hat ein Kulturdezernent, Tim Renner, aus der Volksbühne eine Art Kulturkombinat schaffen wollen – dazu sollte ein Kino, ein Hangar auf dem Flughafen, ein Ausstellungshaus und eben das Theater mit zwei Spielstätten und einer eigenen Onlineplattform gehören. Das war eine echte Vision. Dass sie sich den richtigen Ort ausgesucht hat, glaube ich nicht, aber das geht ganz in die Richtung, von der Sie sprechen. Als Generalintendanten, oder Unipräsidenten in Ihrer Metaphorik, hat Tim Renner den belgischen Kurator Chris Dercon eingeladen. Das hat nicht gut funktioniert, aber das hat mit der besonderen Rolle der Volksbühne und der Geschichte Ostberlins oder des „Ostens“ in einem weiteren Sinne zu tun. Mit solchen Gedanken sind Sie also nicht allein. Bei den Berliner Festspielen ist es so, dass ich tatsächlich als das größte Kapital nicht unser Budget begreife, sondern unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Als Betrieb sind die Festspiele eine sehr moderne, flexible Konstruktion – wir richten unsere Strukturen nach den Werken und Themen aus, wir arbeiten in Netzwerken und machen eigentlich alles außer Oper, insofern es innovativ ist. Und das mit einem Pool von Spezialisten, die wir über viele Jahre an uns binden konnten. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie sich jedes Mal wieder jemanden suchen müssten, der sich mit Fluchtplänen und Sicherheitsabständen und Genehmigungsverfahren auskennt und all dem… Es hat einfach unglaubliche Vorzüge, institutionelle Kerne zu pflegen, in denen das Know-How überwintern kann. Ich spreche von Kompetenzzellen: Die Einen kennen sich mit Theater aus, die anderen mit Musik, wieder andere mit bildender Kunst, zum Teil vermischt sich das künstlerisch, aber auch im Bereich Technik oder in der Personalleitung und im Vertragswesen. Die Arbeit in der freien Szene ist ja oft so mühsam, weil man sich dort um so vieles gleichzeitig kümmern und sich jegliche Struktur selber aufbauen muss. Auch wenn die Projektarbeit große Vorzüge hat, sind Institutionen sehr wichtig, vor allem auch aus Arbeitnehmersicht, weil sie hier ihre Recht durch Betriebsräte und Gewerkschaften viel besser vertreten können. Wir müssen also aufhören, diese beiden Systeme gegen einander auszuspielen, und auf etwas Drittes setzen, das beide Produktionswelten überbrückt. Ein sehr gutes Werkzeug dafür wäre aus meiner Sicht das bedingungslose Grundeinkommen, das die Entscheidung, wo man arbeiten will, von der Existenznot abkoppelt. Es darf nicht sein, dass ich bei einer Arbeit in der freien Szene duldsamer sein muss bei drohender Armut und soziale Benachteiligung. Und umgedreht darf es nicht sein, dass wir die Erstarrung und Besitzstandswahrung, die sich in den zunehmend ausgezehrten Institutionen eben schnell herausbildet, zementieren.
JONAS zipf: Also eine Art Balance zwischen fest & frei?! Eine Balance in dem Sinne, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielt. Aber es besteht dennoch die Frage nach der Kommensurabilität dieser beiden Produktionskulturen, weshalb ich nochmal auf das Verhältnis von Kunst und Institution zurückkommen will. Bei Christoph Menke gibt es in „Kraft der Kunst“ am Ende des ersten Teils einen ganz kurzen Absatz, nicht mehr als zwei Seiten, im dem er beschreibt, wie die Bayreuther Festspiele entstanden sind. Er geht dafür zurück auf die Prinzipien des Dionysischen und des Apollinischen, so wie Nietzsche in seiner „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ beschreibt. Das eine ist die quasi ungerichtete Kraft, das Dionysische, die „Kraft der Kunst“. Es gibt etwas zu sagen, und das muss gesagt werden. Und dann gibt es eine Form dafür. Die Formgebung ist die andere, die apollinische Seite, die dieser Kraft eine Übersetzung bietet. Als Gegenüber zur Kunst ist das die Institution. Menkes These: Eigentlich kommt es auf die Balance zwischen beiden an. Indem die Institution die Kunst begrenzt und die Ressourcen definiert: Geld, Personal oder auch den Faktor Zeit – indem sie Endpunkte für künstlerische Prozesse setzt, etwa Vernissage- oder Premierentermine. Die Institution organisiert Ressourcen, Aufmerksamkeit und Kommunikation. Und diese Begrenzungen machen es überhaupt erst möglich, dass andere, die Zuschauer, daran teilhaben. Keine der beiden Seiten darf dominieren: Sonst findet die Kunst entweder keine Öffentlichkeit mehr, oder sie wird von der Institution erdrückt.
THOMAS OBERENDER: Ich weiß nicht, ob wir die soziale Frage auflösen, wenn wir über das Verhältnis zwischen Kunst und Institution sprechen, obwohl ich Christoph Menkes Balance-Modell sehr schön finde. Ich glaube eher, wir müssen aus dieser Dichotomie zwischen „frei“ und „institutionell“ aussteigen und ein anderes Verständnis von Arbeit anwenden. Ich glaube, dass die aktuelle, von Covid verursachte Zwangspause die beste Zeit ist, um über ein leistungslos gewährtes, sprich bedingungsloses Grundeinkommen zu sprechen. Plötzlich müsste in dieser Gesellschaft niemand davor Angst haben, seine Krankenkasse, Altersvorsorge und Grundversorgung (Wohnraum, Nahrung, Kleidung) nicht bezahlen zu können. Wenn uns diese Prekarisierungsangst genommen würde – und man hat ausgerechnet, dass das nicht teurer wäre, als all die Förderungen und Sonderhilfen, die es auch jetzt schon gibt –, dann würden sich viele Streitigkeiten sofort entspannen und auf eine andere Ebene verlagern. Denn dann geht es nicht mehr um die Grundlebenssicherung, die für viele Menschen aktuell ein hartes Thema ist, sondern eher darum: Wie wollen wir arbeiten? Geht das an zwei Tagen auch von zu Hause? Wofür soll unsere Arbeit stehen? Ist sie nachhaltig? Was soll sie bewirken? Motiviert sie Menschen, sich im Bereich social care zu engagieren, weil das plötzlich viel besser bezahlt wird als ein Grundeinkommen? Wer darf da mitwirken? Dürfen Spekulanten weiter auf Lebensmittel, Wohnen und Staatsschulden wetten? Und so weiter. Die Umweltphilosophin Barbara Muraca hat darüber viel geschrieben. Also wenn man, um auf unseren Bereich zurück zu kommen, die Frage der Anstellungsform von der Grundsicherung entkoppeln könnte, und zwar auch wirklich entkoppeln von Wettbewerbsgedanken, wenn man das unterbrechen könnte, wäre das ein Riesenschritt, den wir in dieser Krisenzeit intensiv diskutieren sollten.
JONAS zipf: Also letztlich ginge es darum, unser Menschenbild zu befragen: Entsteht die Motivation zur Arbeit immer nur aus der Belohnung für Leistung? Entsteht Anerkennung nur durch Geld? Die Frage wäre ja, ob wir das Grundeinkommen als gesamtgesellschaftliches Modell benötigen? Oder ob dieses Modell nicht erst mal das Spannungsfeld zwischen Kunst und Institution auflösen könnte? Also ein Modell wie das früher in Frankreich, bevor es weggekürzt wurde: Eine Grundsicherung für die Künstler*innen, „Intermittants du spectacle“ genannt.
THOMAS OBERENDER: Die große Revolution wäre ja, das gesamtgesellschaftlich zu betreiben. Und damit auch einen anderen Arbeitsbegriff durchzusetzen. Wenn Sie sich vor Augen führen, was eben alles nicht als Arbeit verstanden und mit Anerkennung oder Rentenansprüchen honoriert wird – von der Kindererziehung bis zur Pflege von Angehörigen, dann ist das nicht gerecht. Ich sehe diese Debatte tatsächlich in einem größeren Zusammenhang. Da geht es nicht nur um einen neuen „Green Deal“ als Konjunkturprogramm, sondern um die Frage, wie wir unsere Lebenspraxis in andere Zusammenhänge einbetten, indem wir uns auf das Nachhaltige, das weniger Zerstörerische, das Heilende konzentrieren – also etwas, das unsere Gesellschaft in der Art, wie sie mit dem Planeten und den Menschen umgeht, dringend entwickeln muss. Dafür müssen wir neue Strukturen schaffen, die der Daseinsfürsorge dienen, und nicht der Wettbewerbslogik folgen. Also wenn man die Diskussion der Arbeit in diese neue Nachdenklichkeit einbettet, etwa so, wie es beispielsweise Bruno Latour seit Jahren vorschlägt, dann geht es nicht nur um ein Bewusstsein für den Arten- und Klimaschutz, sondern um neue politische und aktivistische Konzepte zum Schutz der lokal verwurzelten Commons. Dann sprächen wir über ein gänzlich anderes Verständnis von Daseinssicherung, Daseinsfürsorge, die dabei unseren Planeten als Ganzes im Blick hat.
JONAS zipf: Es wird darauf ankommen, so kann man es auch formulieren, wie wir aus der Krise rauskommen und ob wir wirklich begreifen, um welche wesentlichen Dinge es gehen muss… „Less is more“ war vorher ein Punkt. Worauf kommt es an? Was ist mir am wichtigsten? Nach Corona arbeiten und konsumieren wir dann vielleicht ein bisschen nachhaltigkeitsgerechter, regionaler, saisonaler, virtueller. Und in unseren Kunst-Institutionen versuchen wir uns auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens würde die staatliche Förderung von Kultur-Institutionen auf zwei Fragen konzentrieren: Welche Rolle will die öffentliche Hand spielen und für welche Kostenarten ist sie zuständig? Wir würden uns nur noch um die betrieblichen Rahmenbedingungen und um die jeweiligen, vor allem finanziellen, Ressourcen für die Produktion kümmern. Denn die Leute selbst wären davon entkoppelt.
THOMAS OBERENDER: Das Grundeinkommen ist kein Einheitslohn für alle. Ich denke, dass die Entlastung eher in den öffentlichen Verwaltungen spürbar wäre, die sich sonst mit 1000 Antrags- und Beihilfefragen beschäftigen. Differenzierte Gehälter oberhalb der Basisversorgung würden weiterhin bestehen.
JONAS zipf: Wenn das individuelle Einkommen nicht mehr von Projektgeldern abhängt, würde auch die häufige Selbstausbeutung von Künstlern und Künstlerinnen aufhören, die ja für das Geld oft wesentlich mehr arbeiten als sie beantragt haben. Härtere oder weniger begehrte Arbeiten würden besser bezahlt.
THOMAS OBERENDER: Das wäre interessant. Prinzipiell wäre für jeden Künstler wie auch jeden Handwerker oder Studenten das Leben gesichert.
JONAS zipf: Das würde die gesamte Diskussion verändern und sie verliefe viel stärker entlang der konkreten Erfordernisse der Kunst. Das wäre extrem spannend. Wir würden stärker über das reden, was sonst ja ständig wegschmilzt, den eigentlich künstlerischen Etat.
THOMAS OBERENDER: Ja. Ja. Das ist eine schöne Vorstellung.
JONAS zipf: Ja. Über genau das, was sonst bei jeder Tarifsteigerung und jeder inflationsbedingten Steigerung der Kosten für Immobilien und Betrieb, immer weiter abschmilzt.
THOMAS OBERENDER: Was sicher so bleibt. Aber auch das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja nicht statisch, und nicht Alle sollen und dürfen nur auf diesem Niveau bezahlt werden. Es verschafft individuell allerdings eine neue Freiheit in der Entscheidung, was und wo man arbeitet.
JONAS zipf: Wir hätten aber auch eine Größe in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und mit der Politik, weil wir auf dem Niveau der Grundsicherung an keine Stellenpläne gebunden sind, weil Qualifizierungsangebote, Feedback, Mitbestimmung eine ganz neue Rolle spielen würden.
THOMAS OBERENDER: Und so, wie es in der Wirtschaft Mindesteinkommen gibt und bei Managern die Diskussion über Maximaleinkommen, wird eine solche Deckelung ja auch im Kunstbereich diskutiert, insbesondere im Bereich der Solisten und Dirigenten. Sind individuelle Abendgagen von 20 oder 30 Tausend Euro an staatlich ausgebildete Solisten oder Dirigenten in staatlich geförderten Strukturen zu rechtfertigen?
JONAS zipf: Was ja auch unheimlich schwer nach außen zu erklären ist. Die Revolution des bedingungslosen Grundeinkommens wäre aber vor allem, dass man wieder stärker über den eigentlichen Raum der Kunstproduktion redet. Das ist schön, das gefällt mir.
THOMAS OBERENDER: Ja. Also ja, es ist ein bisschen ideal gesprochen, aber dem folge ich gerne.
JONAS zipf: Corona heißt ja im Wortstamm lateinisch Kranz oder Krone. Also etwas, was nach außen strahlt. Dieser Begriff, der hat ja eine sinnbildliche Dimension für das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Was strahlt ab? Was lernen wir daraus? Ohne, dass wir der Gefahr anheimfallen, zu viel da hinein zu projizieren. Ich habe jedenfalls mindestens genauso viele Ängste. Sie haben Latour ins Gespräch gebracht und damit kommen zu noch größeren, schicksalhaften Fragen. Ich spreche vom Klima, der Frage der Menschheit im globalen Maßstab. Vom Anthropozän.
THOMAS OBERENDER: Was verstehen Sie darunter?
JONAS zipf: Es stellt sich doch die Frage: Vernachlässigen wir nicht all die uns bestimmenden Kräften? Diese Annahme eines Anthropozän ist doch letztlich eine Hybris. Wer, wenn nicht der Mensch, wollte behaupten: Wir können die ganze Naturgeschichte mit ein paar Jahren Menschheitsgeschichte eliminieren. Denn wir sind jetzt die Krone der Schöpfung, um beim Wort „Krone“ zu bleiben…
THOMAS OBERENDER: …ja, das ist so. Diese Überbetonung des Faktors Mensch ist irgendwie auch fragwürdig in diesem Titel für ein Zeitalter…
JONAS zipf: …Genau, als ob sich alles nach uns richten würde. Als ob wir die Natur überwunden hätten…
THOMAS OBERENDER: …Der Ausgangsgedanke für diese Wortschöpfung war ja lediglich, dass wir, unsere Spezies, plötzlich selber zu einer Naturgewalt geworden sind und seit dem Beginn der Moderne durch die Industrialisierung so katastrophale Naturzerstörungen im Erdsystem angerichtet haben, wie früher nur ein gesamtes geologisches Zeitalter…
JONAS zipf: …Genau. Und eigentlich erleben wir ja gerade, wie unglaublich fragil und wie sehr wir der Natur ausgeliefert sind.
THOMAS OBERENDER: Stimmt. Wer weiß, was da im auftauenden Permafrost noch so alles lauert. So ein kleines Virus legt alles lahm.
JONAS zipf: Aber nicht nur in diesem banalen Sinne des Virus, sondern vor allem: Wie dünn ist die Schicht unserer Zivilisation? Wie schnell geht es plötzlich einfach nur noch ums Fressen und ums Überleben?
THOMAS OBERENDER: Guter Punkt. Aber das kann man eben leider auch für unser Verhalten in Zeiten sagen, die keine Krisen sind. Wir fressen den Planeten auf. Dieses Gebot ewigen Wirtschaftswachstums führt zur Überlebensfrage der gesamten Biosphäre. Wir sind das Virus. Bruno Latour spricht im Hinblick auf die dünne Schicht, in der sich alles Leben auf der Erde abspielt, übrigens von der Critical Zone. Zehn Meter in der Erde und zehn Meter über der Erde ereignet sich auch das, was Sie Zivilisation nennen. Wenn wir diese dünne Schicht versauen und kaputt machen, stirbt alles.
JONAS zipf: Ich meinte das jetzt eher im Freudschen Sinne: Die dünne Schicht der Zivilisation. Man sieht ja, wenn man sich die Vereinigten Staaten momentan anschaut, wie sich jegliche politische und gesellschaftliche Kultur in kürzester Zeit auflöst. Alle kaufen Waffen. Es herrscht die pure Existenzangst. Jeder ist sich selbst am nächsten. Und darin steckt einfach diese banale Erkenntnis, dass wir überhaupt nicht so fein ziselierte Zivilisationswesen sind, sondern einfach Naturwesen. Am Ende geht es einfach darum, dass der eine länger überlebt als der andere.
THOMAS OBERENDER: Das klingt nach Sozialdarwinismus. Das sagen Sie, weil Sie in Jena leben, in der Stadt von Ernst Haeckel.
JONAS zipf: Im Gegenteil, ich sage das im Sinne einer heilsamen Erfahrung. Im Sinne von Demut, was unsere Rolle als Menschen gegenüber der Natur anbelangt. Wir koexistieren in einer Gemeinschaft mit anderen Wesen, mit Pflanzen und Tieren, dem Klima und Landschaften. Deswegen finde ich: Kultur im Anthropozän, das kann ja eigentlich nur heißen, zu fragen: Wie zeigt sich unser Verhältnis zur Natur?
THOMAS OBERENDER: Wo werden andere Akteure als die menschlichen hör- und sichtbar? Und wie kriegen wir die in diese Maschinen, in diese Institutionen rein, die im Moment das sind, was wir fast ausschließlich bespielen? Das ist die große Frage. Das finde ich eine wertvolle Beobachtung von Ihnen. Sie benennen das Problem, finde ich, sehr präzise.
JONAS zipf: Insofern wäre Corona ja insgesamt nichts anderes, als eine Krise, die uns zurückwirft auf das Maß, das wir tatsächlich haben.
THOMAS OBERENDER: Im Grunde ist Corona eine Art von biologischem Aktivismus. Und es wäre natürlich schöner, wenn er für manche Menschen nicht tödlich wäre. Aber sonst wären die Flugzeuge auch nicht am Boden und die Autos nicht in den Garagen geblieben. Das Virus funktioniert wie eine dieser Occupy-Aktionen, die große Straßen in London oder New York lahmlegten. Ich denke an Occupy Wallstreet oder Occupy Museums von Noah Fischer. Also dieser Versuch, übliche Routinen zu unterbrechen und in dieser Pause eine andere Art von Gespräch zu ermöglichen. Ohne zu wissen, wo es hinführt. Im Unterschied zu den Revolutionen alten Typs, bei denen immer eine Avantgarde das Ziel schon kannte. Und die alten Strukturen reproduziert, sobald sie sich an ihre Spitze setzt. Deshalb ist aktuell das Interessante, dass wir nicht wissen, wohin Covid uns führt. Es wird einfach eine Pausentaste gedrückt, weltweit. Und wir fahren alle auf Sicht und wissen nicht, wo die Reise hingeht. Von Woche zu Woche tasten wir uns ein Stück weiter. Jedes Land auch ein bisschen anders. Das ist die wertvollste Zeit, die unsere Gesellschaft und, pathetisch gesagt, die Weltgesellschaft seit langem hatte. Das ist die globale Erfahrung einer Ausnahmesituation und Offenheit, wie sie für eine kurze Zeit auch die ostdeutsche Wende hervorgebracht hat. Das, diese Generalaussprache einer ganzen Gesellschaft, war 1989 das wesentliche Moment der Revolution. 1989 – das hieß die Pausentaste drücken. Bevor der Einheitsvertrag, der Beitritt kam, waren das der kollektive Versuch und die experimentelle Praxis eines ganzen Landes, die Gesellschaft auf allen möglichen Ebenen neu zu denken. Danach kam das Alte.
JONAS zipf: Jetzt, glaube ich, kriegen wir nochmal die Kurve zur Verantwortung, die wir als Chefs von Kulturinstitutionen haben. Gemessen an dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen wäre es jetzt fatal, sich auf diese Verteilungskämpfe im vorauseilenden Gehorsam einzulassen.
THOMAS OBERENDER: Die gibt es doch schon die ganze Zeit.
JONAS zipf: Ja, die laufen auch jetzt längst im Hintergrund. Fast reflexhaft. Aber in dieser Krise nur darauf zu achten, dass man möglichst präsent ist über virtuelle Angebote und dergleichen, um seine eigene Position für die Zeit danach zu stärken, das ist doch eine vertane Chance! Natürlich ist das für Viele momentan schon eine wirklich existenzielle Situation, einerseits. Andererseits aber auch eine Kakophonie von denen, die am lautesten schreien können. Öffnend wäre es, wenn wir von unserer Position als Kulturschaffende her sagen würden: Hört auf mit dem Verteilungskampf. Die große Lehre ist doch: Der Staat, die Gemeinschaft, nur die schafft es, die verletzliche Schicht der Zivilisation intakt zu erhalten. Nur wenn eine Art Gemeinschaftsverabredung dafür sorgt, dass die medizinischen Kapazitäten nicht überlastet werden, können wir das jeder für sich heil überstehen. Was noch bei der letzten Pandemie in Deutschland nicht möglich war, bei der Spanischen Grippe vor knapp hundert Jahren. Heute erscheint uns das möglich aufgrund unseres Vermögens, im Sinne von materiellem Wohlstand, aber auch eines Vermögens an immateriellen, ethischen Werten, die wir gemeinsam verteidigen, die stark genug sind, stärker als die dünne Schicht der Zivilisation.
THOMAS OBERENDER: Ehrlich? Der NSU kommt aus Jena.
JONAS zipf: Aber auch Jürgen Fuchs. Wir als Kulturschaffende müssten doch der Gemeinschaft zurufen: Besinnt euch doch auf diese Werte und dieses Vermögen, sozial zu handeln, statt Verteilungskämpfe zu führen, und gebt uns die Möglichkeit, immaterielle Werte, zum Beispiel im Kulturbereich, von den materiellen zu trennen…
THOMAS OBERENDER: …Also ich möchte niemandem etwas zurufen. Verteilungskämpfe sind ja auch irgendwie gut. Sonst würde es jemanden geben, der alles zuteilt. Das hatten wir in der DDR. Aber trotzdem haben Sie Recht, weil Sie einen Schritt raus aus der Maschine machen. Und das hieße aber, die Pause aushalten… Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reinplatze, aber das gefällt mir eben sehr gut, wie sich das Gespräch entwickelt. Das ist im Grunde dieses aktivistische Moment der augenblicklichen Situation, die so viele Stimmen hörbar macht. Also nicht nur die klagenden und die fordernden, sondern auch jene, die das Betriebssystem grundsätzlich hinterfragen – unser Gesundheitssystem ist krank, seit es die Einzelfallpauschale gibt. Mediziner fangen an, öffentlich darüber aufzuklären, wann der entscheidende, verschlechternde Schritt stattgefunden hat, der das System nicht mehr dafür belohnt, wenn es Heilung fördert, sondern wenn es Aufwände produziert. Und diese Nachdenklichkeit, die in dieser Pause entsteht, die in so viele Richtungen geht, die ist das größte und wertvollste Geschenk dieser Krankheit.
JONAS zipf: Also Herr Oberender, das ist jetzt ein Schlusswort. Am Ende dieses Telefonats müssten wir ja jetzt eigentlich fragen: Was steht unter dem Strich dieses Gesprächs? Was lernen wir für die Zeit nach Corona und so weiter? Nein, eben nicht! Man muss das aushalten. Man muss die Pause aushalten.
THOMAS OBERENDER: Ja genau, eben nicht. Genau, das finde ich noch einen guten Gedanken– das wäre der Satz, der über dem Gespräch steht.
JONAS zipf: Ja.
THOMAS OBERENDER: Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das kommt im Juli raus. Das heißt: „Empowerment Ost“. Und es beschreibt die 89er-Revolution als die „erste Revolution des 21. Jahrhunderts.“ Weil sie keine Partei hatte, weil sie keine Programmatik hatte, sondern sie war ein Protest, der Offenheit erzeugte – eine Art von Generalaussprache in der Gesellschaft, die nach 1990 nie wieder in dieser Intensität und Breite stattfand. Und siehe da: Corona bewirkt jetzt wieder eine solche Generaldebatte.
JONAS zipf: Genau. Und wir sagen jetzt gerade, das ist der entscheidende Punkt, wir sagen: Eben nicht, gerade jetzt eben nicht.
THOMAS OBERENDER: Übrigens, vielleicht ein letzter Gedanke, der mir beim Zuhören kommt: Auch Angst gehört dazu. Auch dass Leute jetzt klagen und mit dem Finger auf sich zeigen und anfangen zu schreien, weil sie Furcht haben. Alles erlaubt. Gehört alles dazu. Also es ist nicht falsch, wenn Menschen jetzt um Hilfe rufen und so weiter. Ja? Das ist nur ein Klang innerhalb dieses größeren Tableaus von Verlautbarungen. Ich fände es auch nicht gut, wenn wir sagen: Jetzt seid nicht so egoistisch. Es ist in Ordnung, wenn jetzt ein paar Leute egoistisch sind.
JONAS zipf: Das wäre auch keine gelingende Rolle, die wir für uns als Kulturakteure beschrieben…
THOMAS OBERENDER: …Nein, ne? Wenigstens bei uns muss man Mitgefühl finden, keine Angst vor der Angst, bei uns wird geweint und geblutet, alles, was draußen weggewischt und breitgetreten wird, dem geben wir Raum und Würde, nein, die müssen wir nicht erst geben, nur den Raum…
JONAS zipf: …Wir müssen das eher aushalten, das Forum öffnen oder bieten, wo das stattfinden darf. Ich beziehe das jetzt konkret auf unsere Situation hier in Jena. In der ja momentan viel Druck entsteht. Das ist auch für mich gerade versöhnlich und heilsam, das aus unserem Gespräch mitzunehmen, als Impuls in den weiteren Arbeitstag. Deswegen war das eine sehr schöne Zwischenstation mit Ihnen heute Nachmittag. Auch das gehört dazu…
THOMAS OBERENDER: …Sie sind ja der Meister des Bogenbaues, des Bogenschlagens…
JONAS zipf: …Ja ich finde jetzt einen Moment, wo ich sozusagen auf die Stopp-Taste drücke. Nämlich genau…
Was denken Sie über ein „bedingungsloses Grundeinkommen“? Könnte es helfen, die Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen?