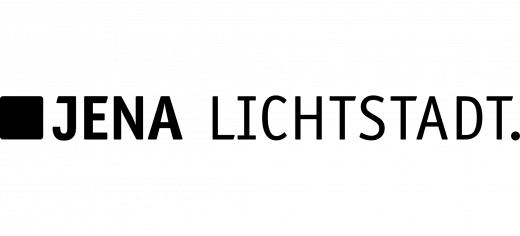Ein Corona-Gespräch über Kultur und Bildung, Demokratie und wie diese miteinander zusammenhängen
Der Eine hat seine Bildungskarriere gewissermaßen hinter sich: Der Pädagoge Peter Fauser, emeritierter Professor für Schulpädagogik, Begründer der Jenaer Imaginata und gefragter Berater und Akteur in den Bereichen der technisch-wissenschaftlichen und politischen Bildung, betrachtet die Ereignisse der Coronazeit aus einer kritischen Halbdistanz. Dem Anderen steht sie gewissermaßen noch bevor: Mit drei kleinen Kindern im Alter von 6, 4 und 1 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Frage nach einer ganzheitlichen Bildung und Individuation.
In ihrem Telefonat am ersten Tag des diesjährigen Jenaer Schneedesasters sprechen die Beiden über Bildung und Zivilisation, über Unterschiede und Gerechtigkeit, über Kultur und Digitalisierung.
JONAS ZIPF: Es könnte keine passendere Situation für unser Gespräch über Bildung und Chancengerechtigkeit geben als die, in der wir uns jetzt treffen. Ich trage hier unseren Neugeborenen, unser 3. Kind, im Tragetuch. Um 13 Uhr gehe ich mit dem ältesten Sohn in die Logopädie; die Tochter ist am Zoomen mit ihrer besten Freundin: Die zwei können sich nicht sehen, weil der Vater infiziert ist. Und der kleine Mann brabbelt jetzt in unser Gespräch mit rein. Und Dich erwische ich zwischen Schneeschippen und Enkelbesuch. Passender könnten wir es nicht auf den Punkt bringen. In der Pandemie ist das die Realität von Millionen Menschen in unserem Land, heute noch mal besonders zugespitzt, weil der massive Schneefall von heute Nacht jetzt sogar noch die Notbetreuung der KiTas und Schulen ausfallen lässt. Irgendwie ist es einerseits ganz magisch: Du hast das ja in deinen Gedichten geschrieben, in dieser Phase in der sowieso alles einfriert, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt doppelt und dreifach einfriert. Andererseits aber auch ganz traurig: Ich glaube, wir brauchen nicht lang darüber zu diskutieren, dass die aktuelle Situation der Familien ein Brandbeschleuniger in Richtung Chancenungerechtigkeit ist, dass bereits vor der Pandemie bestehende Unterschiede zwischen den Bildungskarrieren durch Corona massiv verschärft werden. Die Kinder all diejenigen, die zu Hause genug Platz und insgesamt gute Bedingungen haben, sind weniger leidtragend als die, bei denen die Verhältnisse zu Hause nicht so gesund sind. Das ist eine extreme Herausforderung für Bildungschancengerechtigkeit. Oder?
PETER FAUSER: Was durch Corona passiert, wird jetzt nochmal auf eine ganz groteske Art und Weise verschärft durch den Wintereinbruch, durch das Klima. Das ist ein Phänomen, das wir schon lange kennen: Jede didaktische oder technische Krise, und absurd genug, auch jede Innovation geht vor allem zu Lasten der Schwächeren. Im Grunde entwickelt sich die Chancensituation so ähnlich wie die Verteilung von Reich und Arm. Wir sehen, dass die Differenzen immer größer werden, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und so ähnlich läuft das im Bildungswesen auch. Ich sehe das in der eigenen Familie: Eine meine Töchter ist Lehrerin von Beruf, promovierte Anglistin, ihr Mann ist Amerikanist und macht momentan eine Lehrstuhlvertretung. Auch sie betreuen ihre Kinder gerade parallel im Homeschooling. Aber egal wie stark sie selber belastet sind, schaffen sie es, ihre vier Kinder zu Hause rundum gut zu betreuen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kinder mit einem Vorsprung in die Schule zurückkommen werden. Denn ein Problem – oder eine Qualität – der Schule fällt derzeit weg: Das Lerntempo in der Schule hängt sehr stark davon ab, wie schnell die Schwächsten sind. Man sagt zwar, das sei kein Problem, sondern eine Stärke, weil alle lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und alle dabei begreifen, dass es Unterschiede gibt. Aber die Kinder, die jetzt zu Hause gut versorgt sind, die machen so etwas wie eine zugespitzte Erfahrung von Gewinn durch Individualisierung. Die Kinder, die zu Hause nicht gut betreut sind, die werden wahrscheinlich vorm Fernseher hängen oder sonst irgendwie die Zeit totschlagen, weil sie keine entsprechenden Angebote bekommen.
JONAS ZIPF: Diese Individualisierung übersetze ich mit der Sekundärtugend der Selbstorganisation: Die privilegierten Kindern erleben auch weiterhin eine Struktur in ihrem Tagesablauf, im Lernablauf, im Handlungsablauf. Dieser Softskill ist eine starke Voraussetzung für die spätere berufliche Realität. Daran machen sich soziale Unterschiede fest. Und damit letztlich die Chancen und Risiken, für das, was wir in einem breiten Sinne Inklusion oder Teilhabe nennen.
Du bist dafür bekannt, stark für Demokratie-Teilhabe zu kämpfen. Auch mit Mitteln der Pädagogik und der Bildung. Ich selbst bin Schüler einer reformpädagogischen Schule gewesen, auf der in der Oberstufe Schüler*innen verschiedener Gymnasien und Realschulen zusammenkommen. Da begegnen sich also Schüler*innen, deren Weg zum Abitur vorgebahnt schien, und Schüler*innen, die für die Mittlere Reife vorgesehen waren, nun aber doch noch den nächsten Schritt Richtung Abitur gehen wollen. In dieser Schule war es gesetzt, dass man die Höchstnote, 15 Punkte, immer nur dann bekommen kann, wenn man in der Gruppe arbeitet, im Team lernt. Man konnte sich noch so sehr auf die Hinterbeine stellen und eine perfekte Leistung bringen: Die 15 Punkte hat man nie bekommen, wenn man nicht auch etwas für die Schwächsten in der Gruppe getan hat. Dieser Aspekt ist doch der entscheidende Kitt für eine Gesellschaft, in der im Moment – das sage ich jetzt als Kulturmensch, da gibt es natürlich noch eine Analogie zwischen Bildung und Kultur, eine Seelenverwandtschaft oder Familienähnlichkeit – die physische Kopräsenz, das Aufeinandertreffen der Menschen, komplett wegfällt.
In der Pandemie muss niemand die Differenz zu anderen aushalten, denen er in seinem Alltag sonst selten begegnet. Wenn ich zu Hause bin, muss ich es mit der Familie aushalten, das ist anstrengend genug in dieser Zeit. Aber sonst habe ich nur noch so einen kleinen Rechner vor mir, oder so ein kleines Smartphone, und die Logik dieses Rechners oder Smartphones funktioniert eben so, wie die Algorithmen von Amazon und Co. es vorgeben: „Wenn ihnen Dieses gefällt, dann machen sie doch auch noch Jenes“. Social Media funktionieren wie der Einkaufskorb beim Internet-Shopping: Es wird immer nur das unterstützt und bestätigt, was sowieso schon da war.
Wenn wir allerdings darüber reden, wie Demokratie funktioniert, dann müssen wir doch vor allem aushalten, dass es immer auch andere Sichtweisen und Perspektiven gibt, und gerade solche, auf die wir selbst ohne die Anderen nicht kommen. Diese Begegnungen passieren ganz unwillkürlich, wenn ich zu gesellschaftlichen Orte gehe, an denen ich Menschen begegne, die ich mir nicht aussuche. Als solche erkenne ich als Kulturmensch neben der Schule natürlich die Räume der Kunst, Kultur und Kulturellen Bildung. Als Besucher eines Konzerts oder einer Theateraufführung bin ich mit einem Sitznachbarn konfrontiert, den ich mir nicht aussuchen konnte und übrigens auch damit, dass die da oben auf der Bühne etwas machen, was mir möglicherweise nicht passt. Hier entstehen doch Sozialkompetenzen, die eine wesentliche Grundlage für Demokratie bilden. Und die gehen in der Pandemie nun flöten.
PETER FAUSER: Ich kann das Allermeiste nur mit einem tiefen Seufzen unterstreichen. Ich nehme mal drei Stichworte auf von dem, was Du gesagt hast. Das erste: „Sich eine Struktur geben“. Das sind klassische bildungsbürgerliche Qualitäten. Diese Vorstellung von Disziplin geht zurück auf den Protestantismus. Aber wer kann das schon? Die Antwort ist schlicht: Es sind diejenigen, denen eine Struktur im selbstverständlichen Alltag ihrer Eltern angewachsen ist.
Ein guter Freund von mir, Theologe, ist enorm belesen, ein wirklicher Schriftgelehrter. Der hat früher auf meine Frage „Was machst Du, wenn Du jetzt Nachwuchs bekommst, mit Deinen Büchern?“ geantwortet: „Naja, dann kriegt die Tochter oder der Sohn einen kleinen Schreibtisch, und der steht neben meinem“. Das ist natürlich zugespitzt, aber es betont genau das, was uns anwächst durch unsere Herkunft und durch die Umgebung, in der wir sind. Das ist das, was andere niemals einholen können. Auch für Selbstdisziplin stehen Personen Pate. Bei mir ist das zum Beispiel meine Doktormutter, die immer allein gelebt hat, bis auf eine unglücklich zu Ende gegangene große Liebe, und die als katholische Frau in der Hochschule gegen wahnsinnige Probleme ankämpfen musste. Die ist für mich ein Vorbild, ein Phänomen an Selbstdisziplin. Eine Selbstdisziplin, die aber nicht wie eine Fahne vor sich hergetragen wird, sondern aus einer großen würdevollen Selbstachtung geboren ist. So etwas lernt man nicht durch eine Belehrung. Auch nicht, indem man Mindmaps schreibt oder sich Notizen macht. Da muss es etwas Tieferes geben. So etwas wird angelegt im ursprünglichen Umgang in der Familie, mit den Eltern. Früher hat man von Vorbildern gesprochen. Ich mag dieses Wort nicht, da gäbe es ja dann logisch auch immer ein Nachbild. Ich spreche lieber von beispielgebenden, normgebenden Kräften in der Umgebung, die mit Leidenschaft auf ein Ziel hinarbeiten, und die Befriedigungen zurückstellen können: Das ist etwas, was im kleinsten, im frühsten Alter vermittelt wird. Ja, diese Struktur und Disziplin verstärkt die Chancendifferenz, von der wir vorher gesprochen haben.
Das Zweite, was ich aufnehmen will, ist die Leiblichkeit. Die Frage ist doch, wenn man Online-Konferenzen macht und sich diszipliniert unterhält; was da eigentlich verloren geht im Vergleich zu einer direkten Begegnung.
Dazu gibt es ein bedeutendes Buch von Hans Joas mit dem Titel „Praktische Intersubjektivität“, eigentlich eine Monografie über George Herbert Mead. Die Grundthese ist: Intersubjektivität bedeutet Perspektivwechsel, oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit, andere mit wahrzunehmen. Intersubjektivität entsteht im leibhaftigen Umgang, ursprünglich in der direkten Berührung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind. Das heißt, wir sind zutiefst leibhaftige Wesen. Das, was wir denken und wenn wir mitfühlen mit Anderen, das entspringt der Resonanz, die da entsteht, also einer ursprünglichen, fast kann man sagen: Co-Identität. Ursprünglich ist ja ein Kind Teil des Mutterleibs und Teil der Mutter. Dass wir uns als Individuen verstehen können und den Anderen als einen anderen erleben können, das muss aus dieser symbiotischen Beziehung erst allmählich herausgearbeitet werden, man könnte sagen, durch eine Spirale von Entfernung und Annäherung. Anders ausgedrückt: Der gesamte leibhaftige Kontext, aus dem wir schöpfen, wenn wir Andere verstehen, der wird durch den Tunnelblick am Fernseher oder bei der Zoom-Konferenz praktisch ausgeblendet. Das ist natürlich noch verstärkt, wenn man über die Künste nachdenkt. Künste sind ja zutiefst leibhaftig. Ein Bild, eine Musik, die existiert im Grunde primär in meiner sinnlichen Wahrnehmung, in dem, was mich mitnimmt, komplett. Mir geht es bei bestimmten Musikstücken so, die gehen direkt im Durchmarsch in meine Seele, und dann fließt bei mir das Wasser.
Ich will sagen, dieser gesamte leibhaftige Kontext, den wir erworben haben, und den wir brauchen, um leben zu können – Kinder brauchen Berührungen sonst überleben sie nicht – der fällt bei diesem Online-Tunnel komplett weg. Diese Lücke erleben Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer als einen unerhörten Stress. Das, was normalerweise eine selbstverständliche Umgebung ist, die Gruppensituation in der Schulklasse, in der man eigentlich alle wahrnimmt, bei der man, so wie ein guter Dirigent, vor allem die Abweichungen registrieren muss, weil alles andere eine selbstverständliche Basis ist; das fällt beim digitalen Unterricht alles weg. Und deshalb entsteht ein permanenter, intellektuell potenzierter Empathiestress, der hohe Kosten hat. Ja, auch das geht wieder auf Kosten und zu Lasten der Schwächeren.
Und jetzt mein drittes Stichwort: „Demokratie“. Da greife ich eine Formulierung auf von Michel Tomasello – ich weiß nicht, ob Dir der Name was sagt?
JONAS ZIPF: Selbstverständlich! „Warum wir kooperieren“. Ich bin ein begeisterter Tomasello-Leser.
PETER FAUSER: Genau, er ist Evolutionstheoretiker, evolutionäre Anthropologie ist sein Feld. Und er hat einen Grundbegriff für die menschliche Kultur geprägt, den ich unglaublich einfach und genauso stark finde. Er sagt „Die menschliche Kultur ist eine kooperative Verständigungskultur“. Was heißt das? Sie ist kooperativ – das heißt sie beruht auf Zusammenarbeit. Dabei bezeichnet „Kooperation“ nicht allein die kontrollierte, planmäßige, zweckrationale Organisation von gemeinsamen Handlungen für ein Ziel. Sondern Kooperation bedeutet eine wechselseitige Wahrnehmung und ein Zusammenspiel. Unter bestimmten Umständen ließe sich das als ein zweckfreies Miteinander-Spielen paraphrasieren. Kooperation ist eine Art der praktischen Intersubjektivität und damit die Basis der Gesellschaft. Und das zweite Wort „Verständigungskultur“ weist uns darauf hin, dass wir uns, um zu kooperieren, ab einem bestimmten Grad, verständigen müssen. Das heißt, da kommt Sprache ins Spiel, da kommt Kultur ins Spiel: Zusammenarbeit entsteht mit Hilfe von Sprache und erzeugt Sedimente, einen Niederschlag von Routinen, von Selbstverständlichkeiten, von Gewissheiten, von Erkenntnissen, von Werten – und diesen Niederschlag, als gesellschaftliche Erfahrung, nennt er Kultur. Dadurch entsteht das, was er Wagenhebereffekt nennt – die nachfolgende Generation baut immer schon auf einem Fundus von Wertvorstellungen, von Selbstverständlichkeiten, von Gefühlen auf, die die anderen bereits vor ihr entwickelt haben. Im Grunde ein Gedanke, den Schiller in seiner Antrittsvorlesung als Professor für Geschichte an der Jenaer Universität dann auf seine Art ausformuliert hat.
Jetzt zum Thema Demokratie: Wenn wir das mit der kooperativen Verständigungskultur ernst nehmen, dann ist sie die Basis der Demokratie. Die Demokratie fängt nicht erst bei der Stimmabgabe und den Institutionen, beim Verfassungsrecht und beim konstruktiven Misstrauensvotum oder bei den Wahlkreisen an, sondern die Demokratie beginnt in der – ich sage das jetzt lehrbuchmäßig formelhaft – Erfahrung eines universalistisch orientierten Anerkennungs-zusammenhangs. Das ist jetzt eine komplizierte Formulierung, daher will ich ein Beispiel für das machen, was ich Anerkennungszusammenhang nenne: Einer meiner Kunstlehrer, dem ich sehr viel verdanke, der hat, wenn wir mit den Arbeiten fertig waren, die Arbeiten besprochen wie ein Kunstexperte. Er hat sie besprochen wie die Kunstwerke eines Erwachsenen, ganz deskriptiv, ganz unvoreingenommen, mit einer großen Neugier und mit einer entdeckerischen Genialität, die einem dazu verholfen haben, dass man in der eigenen Arbeit mehr gesehen hat, als man selber wahrnehmen konnte. Das ist eigentlich der Kern von Demokratie. Warum? Es ist eine virtuose Fähigkeit, Andere zu verstehen, das eigene Verstehen sozusagen in den Dienst der Lernprozesse der Anderen zu stellen. Da liegt die Basis. Jetzt muss man das aber mal vergleichen mit dem, was leider immer noch in der Schule, im alltäglichen Unterricht passiert. Da ist die Anerkennung immer noch die Ausnahme. Es gibt wenig Naturtalente bei den Lehrerinnen und Lehrern – wie in allen Berufen. Es gibt viele Routinen, die darauf beruhen, dass die Lehrpersonen sich schützen, Routinen, die dafür sorgen, diese Fähigkeit nicht zu einer kognitiv virtuosen Empathie entwickeln zu können. Demokratie fängt also im unmittelbaren Umgang an. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir untersuchen würden, welche Früherfahrungen die zwei Gruppen der Impfskeptiker oder Impfgegner und der Rechtsextremen gemacht haben, herausfinden würden, dass es beiden Gruppen an dem fehlt, was der Entwicklungspsychologe Erik H. Erikson Grundvertrauen oder Urvertrauen genannt hat. Ohne Urvertrauen entsteht keine Fähigkeit, von den eigenen Bedürfnissen abzusehen und die Bedürfnisse Anderer wirklich wahrzunehmen. Das ist aber die Basis der Demokratie. Und jetzt kann man sich noch überlegen, was da zusätzlich durch die Digitalisierung angerichtet wird. Das ist nicht mehr lustig. Und ja, auch hier tut sich eine Chancen-Schere zwischen Kindern aus den verschiedenen Haushalten auf.
JONAS ZIPF: Aus diesem Exkurs voller faszinierender Bezüge könnte ich jetzt noch Vieles weiter anreichern. Zum Beispiel, wenn wir über den Begriff der Resonanz sprechen, dann kommen wir natürlich unweigerlich zu Hartmut Rosa. Wenn wir über den Begriff der Leiblichkeit sprechen, dann stehen wir im Kontext von Verkörperung, von Embodiment: Ich habe jetzt gerade meinen Sohn, wie gesagt, umgebunden. Das ist das Beglückende an dem Gespräch jetzt schon wieder, dass genau das genau jetzt genau hier stattfindet.
Ich würde aber gern einen Aspekt vertiefen und da noch einmal tiefer reinschauen, weitergehen, den Du mit Tomasello ins Spiel gebracht hast: Den Wagenhebereffekt, dessen, was letztlich an kulturellem Wissen über Generationen hinweg tradiert wird. Das ist ja auch eine Grundvorrausetzung dafür, von sich selber absehen zu können, also zu lernen: Es gibt auch Andere und andere Sichtweisen. Das beginnt damit, dass ich auf etwas aufbaue, was an menschlicher Zivilisation vorher verstanden und tradiert worden ist. Das habe ich ja nicht selbst erarbeitet. Das haben Generationen und Generationen vor mir erarbeitet. Es ist eine Art von Demut, das erstmal zu erlernen und weiterspinnen zu können. Zu begreifen, dass Menschen nur als Zivilisation über die Zeitlichkeit ihres eigenen Lebens hinauskommen, nur auf Grundlage früherer Erfolge dazu in der Lage sind, Pläne zu entwerfen, die über Jahre, Jahrzehnte oder sogar über Menschenleben hinweg entstehen; Projekte darauf auszurichten, dass wir letztlich unser kleines Dasein im Kosmos – um es jetzt mal pathetisch zu formulieren – in den Dienst größerer Entwicklungslinien stellen. Das scheint mir – wir sind jetzt wirklich in größeren philosophischen Schritten unterwegs – eine Grundvoraussetzung dafür zu sein, eine Bescheidenheit zu lernen, dass man Teil einer größeren Gruppe ist, wie auch immer kulturell bedingt. In Asien vielleicht mehr in Form eines Schwarms, bei uns vielleicht mehr in der Betonung von Individuation und Differenz zwischen Individuen. Aber eben doch nur in der Kooperation dieser Individuen entstehen zivilisatorische Fortschritte und Projekte, die die Menschen letztlich über ihre Natur hinaus gebracht haben. Erstmal entsteht Kooperation laut Tomasello aus evolutionären Gründen: um zu überleben als Gruppe, als Stamm. Um die Überlebensgrundlage abzusichern. Damit betreten wir einen Boden, auf dem etwas entstanden ist, was Silke Helfrich – um nun noch eine andere Denkerin, die ich sehr schätze, zu bemühen, die übrigens auch hier in Jena zu Hause ist – mit „Allmende“ und „Commons“ beschreibt. Damit sind die Gemeingüter als Grundlagen unserer Lebensfähigkeit gemeint: Wasser, Luft, der fruchtbare Boden. Die gehören allen und keinem. Und können nur im Zusammenspiel der Gemeinschaft, etwa durch Aufgabenteilung erschlossen und – angesichts des Klimawandels heute vielleicht besonders wichtig: bewahrt werden.
Gestern Abend saß Mascolo bei Anne Will und hat am Schluss der Diskussion im Zusammenhang mit der Globalität der Impffrage sinngemäß gesagt: „Krisensituationen wie diese Pandemie sorgen dafür, dass das Beste oder das Schlimmste des Menschen zum Vorschein kommt“. Ich würde mir wünschen, es wäre mehr vom Besten und weniger vom Schlimmsten. Das ist, glaube ich, ein Boden, den wir in vielen Diskussionen momentan erreichen: Letztlich geht es darum, zu beschreiben, welche Gemeingüter – Commons – wir als Menschen erreicht und errungen, uns als Menschen erarbeitet haben, über eine lange Zeit, zu beschreiben, wie gefährdet diese Güter sind, wie fragil, obwohl sie uns allen gehören, als Gattung. Er bezog sich auf die laufende Impfdiskussion: Darauf, ob wir es im humanitären, im globalen Maßstab schaffen, mit der Sache klar zu kommen oder ob wir lieber Impfnationalismus betreiben. Plötzlich kommen wir auf vielen Wegen an einen Punkt, an dem wir über Commons – über Allgemeingüter – reden.
Und dann hast Du da noch ein kleines Wort genannt, das ich entscheidend finde: das Wort „absichtslos“. In Schillers Philosophie der Geschichte oder auch in seiner ästhetischen Philosophie gibt es den Spielbegriff, die Beschreibung des absichtslosen Spiels. Das sind Orte, an denen sich Gesellschaft und Zugang zu den Commons, damit das grundhafte Erlernen von Kooperationen, ereignet. In einer gedanklichen Rückwendung zur Demokratie könnten wir von öffentlichen Räumen sprechen – in einer übertragenen Denkform des Begriffs, der jetzt nicht rein am physischen Raumbegriff festhängt, sondern öffentliche Räume als gedankliche und Kommunikationsräume begreift. Derartige öffentliche Räume sind erstmal genauso absichtslos, vorzeichenfrei, auch wenn uns solche Orte zunehmend verloren gehen. Das sind Orte, an denen Allgemeingüter ausgetauscht werden können. Wenn wir nur zusehen dabei, wie die vorhin beschriebenen sozialen Unterschiede sich immer weiter auswachsen, wie diese Gesellschaft sich polarisiert, einige Wenige noch viel stärker aus der Krise herausgehen und davon profitieren, auf dem Rücken vieler anderer, dann werden wir diese Qualität gefährden: Das, was Habermas „Projekt der Moderne“ genannt hat, kündet doch vom Glaube daran, dass wir mit den Mitteln unserer Zivilisation, oder wie Tomasello es beschreibt als kooperierende Gattung mit immer größeren und komplexeren Problemen klar kommen können. Die Risiken sind größer geworden, aber wir kommen mit ihnen klar, wenn wir als Menschheit gemeinsam da durchgehen.
PETER FAUSER: Ich fange bei dem Begriff der „Absichtslosigkeit“ an. Der erzeugt möglicherweise ein Missverständnis. Das wird deutlich, wenn wir den Begriff der Absicht und den Begriff des Zwecks miteinander verbinden. Nicht jede Art von intentionaler Kooperation ist zweckrational. Im strategischen Handeln gemäß Habermars wird der Andere als Mittel für meinen Zweck eingesetzt. Ich habe dann eine dominierende Intention, der alles andere untergeordnet wird. Anders ist es, wenn ich künstlerisch interagiere, wenn ich beispielsweise mit jemanden zusammen musiziere, dann mache ich das ja nicht absichtslos; das heißt, ich habe auch eine Absicht – nämlich die, möglichst gute, möglichst genau aufeinander abgestimmte Reproduktion oder Produktion von Kunst. Das ist zwar nicht zweckrational, wohl aber absichtsvoll. Diese Differenzierung ist mir sehr wichtig. Ich glaube, entscheidend ist, dass nicht Andere instrumentalisiert werden. Beim freien Spiel ist die Idealform der Absichtslosigkeit erreicht, auch im Theater oder in der Kunst, in der Musik für mich am ausgeprägtesten. Da gibt es aber zugleich auch eine ganz starke Intentionalität. Die Musik von Beethoven zum Beispiel ist für mich reine Intention, und insofern ist für mich, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, Absichtslosigkeit nicht unbedingt identisch mit dem was ich Zweckfreiheit nenne, sondern das sind zwei verschiedene Dinge. Intentional muss es sein und darf es sein, aber nicht zweckrational orientiert.
Dann zum öffentlichen Raum. Was ist das eigentlich? Wenn man ihn als soziales Phänomen anschaut, dann beschreibt doch der öffentliche Raum eine institutionalisierte Interaktionssituation, in der bestimmte Dinge als selbstverständlich gelten; vielleicht ist der eigentliche Kern des öffentliche Raums, der Öffentlichkeit, die Reproduktion, die permanente Reproduktion von Selbstverständlichkeiten, auf denen unsere Freiheit und Demokratie beruht: die wechselseitige Achtung. Im öffentlichen Raum werden bestimmte Formen der Rücksicht, der Einfühlung, aber auch der Distanz gegenüber dem Anderen, immer aber der Würde und der Achtung, all diese Formen werden als selbstverständlich unterstellt. Jeder, der in den öffentlichen Raum – mit Hannah Arendts „Raum des Handelns“ tritt – tritt in die Welt, in die Geschichte, der ist veranlasst und will eigentlich auch diesen Fundus als Selbstverständlichkeiten – jetzt kann man wieder mit Tomasello sagen: „die tradierte Kultur“ – anerkennen. Deshalb ist Öffentlichkeit so wichtig. Weil sie uns im Grunde mit einer Sanftheit in die wichtigsten – Du sagst dazu Güter, ich sag dazu Wertvorstellungen – hineinführt, die unsere Demokratie am Leben erhalten. Der öffentliche Raum, der ist auch der einzige, der wirklich scharfe Kontroversen oder scharfe Differenzen oder scharfe Auseinandersetzungen auf humane Weise ermöglicht. Überall da, wo Diktaturen entstehen, ist das erste, was stört, die Öffentlichkeit. Zum Begriff der Kultur möchte ich noch ein Wort sagen.
JONAS ZIPF: Bevor wir zum Begriff der Kultur zurückkommen, will ich kurz einhaken. Weil ich die beiden Aspekte miteinander verbinden möchte, die Du gebracht hast. Also, der etwas tiefere Blick auf die Absichtslosigkeit und den öffentlichen Raum: Das scheint mir sehr, sehr eng miteinander zusammenzuhängen. Das, was Du jetzt als Qualität dieses öffentlichen Raums beschrieben hast, kann – das will ich jetzt mal so in den Raum stellen – nur zustande kommen, wenn das Verhältnis von Zweckrationalität und Intentionalität nicht instrumentalisiert wird, so, wie Du es beschrieben hast. Es muss sozusagen ein vorzeichenfreier Raum sein, in dem verschiedene Stimmen hörbar werden können, ohne dass immer gleich etwas instrumentell auf einen Zweck ausgerichtet wird. Diese Grundqualität ist das, was einen öffentlichen Raum per definitionem ausmachen würde. Nur dann ist er eine Voraussetzung für Demokratie. Diese öffentlichen Räume, das sind doch im Moment die wirklich gefährdeten, fragilen Räume. Die sogenannten Social Media sind in der etablierten Form, mit ihren Algorithmen, mit ihren Filterblasen und Echokammern, die nur das bestätigen, was sowieso schon gedacht war, ein vermeintlich großer Inklusionsmotor, scheinbare Treiber menschlicher Kommunikation, aber sie sind kein echter öffentlicher Raum, da sie per se von privaten Vorzeichen dominiert werden. Wir hatten schon vor Corona ein massives Schwinden von öffentlichen Räumen zu beklagen und festzustellen. Wenn wir über Bildung reden, müssen wir ebenfalls über Instrumentalisierung sprechen. Etwa im Hochschulbereich: Wie viel Energie geht hier in Richtung Drittmittel-Akquise, in Richtung Patente und Transfer, in wirtschaftlich zweckinstrumentalisierte Ausrichtungen? Wie viel der Forschung und Lehre bleibt wirklich vorzeichenfrei – absichtslos haben wir gesagt – im Sinne der Güter oder Wertvorstellungen? Da sind diese beiden Aspekte wirklich so eng miteinander verbunden.
PETER FAUSER: Ich habe natürlich jetzt schon wieder andere offene Fenster entdeckt, in dem, was Du sagst. Ich sag ein Wort zum Kulturbegriff und dann will ich noch einmal etwas zum Öffentlichen Raum sagen, zu einem Kernproblem.
Also, zur Kultur, in meinem Verständnis, und zur Bildung, nur um es noch einmal begrifflich etwas klarer zu kriegen. Man kann es ganz einfach sagen: Bildung ist die subjektive Zueignung der Kultur. Kultur ist gesellschaftliche Erfahrung und Bildung, wenn man den Erfahrungsbegriff nicht trivial nimmt. Kultur ist ein Synthesebegriff, der Weg und Ergebnis meiner Erfahrungen und meiner Lernprozesse ausdrückt und zwar nicht wertfrei.
Jetzt nochmal zum öffentlichen Raum. Das fand ich sehr interessant, was Du sagst zur Inklusion. Die digitalen Medien sind, technisch gesehen, inklusiv. Jeder hat einen Zugang. Das ist der Inklusionsbegriff, der weitgehend mit der Luhmannschen Theorie übereinstimmt. Der Gegenbegriff dazu ist das, was Habermas in seiner Demokratietheorie formuliert hat: Die Einbeziehung des Anderen. Die Einbeziehung des Anderen ist die eigentliche Inklusion. Da ändert sich völlig die Perspektive. Da ist also nicht das Prinzip: Jeder hat freien Zugang, sondern: Jeder hat die Pflicht, den Anderen einzubeziehen. Das ist etwas völlig anderes. Bei Schiller gibt es ja diese wunderbare Sentenz, als er an seinen Freund Körner schreibt: „Du weißt, wie wohl man sich in der Gesellschaft von Menschen fühlt, denen die Freiheit der Anderen heilig ist“. Das ist Einbeziehung der Anderen.
Wenn das so ist, und wenn der geistige Kern der demokratischen Öffentlichkeit darin besteht, andere einzubeziehen, dann ist für mich als Pädagoge die Frage: Wie kommt man denn dahin, das zu wollen? Wie kommt man dahin, andere einbeziehen zu wollen? Das ist nicht einfach. Die Freiheit des Anderen für heilig zu erklären, setzt voraus, dass man von den eigenen Ängsten, den eigenen vitalen Interessen, Bedürfnissen und so weiter, dem Triebhaften, absehen kann. Nach meiner Überzeugung geht das nur, wenn man selber Menschen begegnet ist, die genau dies vorleben. Ich habe vorhin meinen Kunstlehrer beschrieben, was der gemacht hat. Das war die Einbeziehung des Anderen. Der hat von sich abgesehen. Ich glaube, das ist die Essenz der demokratischen Kultur, dass wir beispielgebende, normgebende Kräfte, Personen erleben in unserer eigenen Biographie, die uns genau diese Erfahrung vermitteln, dass sie im Interesse unserer Freiheit mit uns kommunizieren, uns so weit entgegenkommen, dass ich das Gefühl habe: „Hoppla, ich bin wirklich frei, der nimmt mich als ein freies Wesen wahr.“
Noch ein bisschen konkreter gesagt: Bestimmte Überzeugungen oder theoretische Potentiale verbinden sich bei mir immer mit Personen. Ich kann sagen, von wem ich Philosophie gelernt habe. Ich kann sagen, wer Pate für mein Musikverständnis gestanden hat. Das ist aber nicht nur so, dass das Reminiszenzen sind an eine vergangene Bildungsbiographie, sondern wenn ich musiziere, dann ist dieser Mensch bei mir, dann bin ich er sozusagen und er steht neben mir. Das ist unglaublich. Wenn ich über bestimmte Dinge nachdenke, dann habe ich das Gefühl „Aha, da ist einer bei mir, der mit mir denkt“. Das meine ich mit der Fähigkeit, die Freiheit anderer zu schätzen. Meine Frage war ja: Wie entsteht diese Fähigkeit, für Andere offen zu sein und nicht die eigene Angst ins Zentrum zu stellen? Die gegenwärtigen totalitären oder diktatorischen Tendenzen sind nichts anderes als der gewaltsame Versuch, die eigene Angst wegzudrücken, die Unsicherheit – Heidegger würde von Sorge sprechen – mit der wir in der Welt sind. Das zu bewältigen – diese man kann auch sagen: Toleranz, Ambiguitätstoleranz – das kann man, glaube ich, nur, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass jemand anderes diesen Raum des großen Vertrauens eröffnet hat. Das ist halt etwas, das geht nicht über die sozialen Medien, das geht nur leibhaftig.
Da können wir jetzt fragen: Wo liegt denn die Zukunft der Schule? Das sehen wir ja jetzt in der Coronazeit noch viel deutlicher als sonst. Es gibt inzwischen im Internet zu jedem didaktischen Problem geniale Antworten. Man schaue sich mal den Mathelehrer Daniel Jung an. Seine kurzen Lektionen werden fast eine Million Mal aufgerufen – täglich, wohlgemerkt. Da gibt es solche Virtuosen der Unterrichtung, wenn es um inhaltliche Vermittlung geht, um kleinste Lernschritte, die inzwischen für jedes Fach alles anbieten, besser als jeder begabte Lehrer. Das heißt, der Schule kommt eigentlich abhanden, wofür sie mal gegründet worden ist, nämlich Wissen zu vermitteln, das in der eigenen Erfahrungswelt fehlt. Was wir aber mehr denn je brauchen, ist die Erfahrung der praktischen Intersubjektivität. Mein Traum einer künftigen Schule ist ein Lernraum, der orchestriert ist mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln, dem auch die ganzen genialen digitalen Angebote angehören. Aber in dem vor allem Personen handeln, die ihre Lernenden wahrnehmen, mit ihren Potentialen und Stärken, und die sie begleiten. Das ist das Ideal der Reformpädagogik, digital vielleicht ertüchtigt oder verbessert, aber nicht neu.
JONAS ZIPF: Darin steckt dann noch eine andere Pointe, die ich, glaube ich, noch einmal übertragen möchte. Was Du beschrieben hast in Bezug auf die beispielgebenden Persönlichkeiten, würde ich in meinen Worten als eine Qualität übersetzen, die es uns ermöglicht, von uns selbst absehen zu können: Wie man über diese enge Wahrnehmung von Welt, wie man aus seinem eigenen empirischen Apparat heraus, hinaus ins Offene kommt und vielleicht, vielleicht, vielleicht die Chance hat, in die Blickwinkel eines Anderen, einer Anderen zu schlüpfen. Luhmann sagt, Kommunikation sei unwahrscheinlich. Wir sprechen also über einen ganz, ganz weiten Weg. Aber den werden wir nicht beschreiten, wenn wir keine Beispiele finden, da gebe ich Dir vollkommen Recht. Letztlich lässt sich dieser Vorgang übertragen auf die Inhalte, die wir dort und dann vermittelt bekommen.
Ich habe ja vorhin von den Algorithmen gesprochen. Deren Logik besteht darin, dass ich ständig das vertiefe und verstärke, was sowieso schon da ist. Ich bekomme eben keinen Heuristikwechsel hin, versuche nicht mehr, etwas anders zu betrachten und damit vielleicht auch auf einen anderen Erkenntnispunkt zu kommen. Das scheint mir, wenn wir noch einmal über Kultur sprechen, auch ein ganz zentraler Erfahrungsschatz in der Kultur zu sein. Etwas vermittelt zu bekommen, was ich so noch nicht gesehen habe, in der physischen – Du hast von der Leiblichkeit gesprochen – Kopräsenz. Damit meine ich jetzt nicht nur die Liveaufführung von Konzerten oder Theatern, sondern physische Kopräsenz kann auch der Besuch einer Ausstellung entstehen, bei der es sehr wohl eine Rolle spielt, dass es eine Haptik gibt, dass Kunst im Raum stattfindet, dass noch andere Menschen anwesend sind. Ich komme als Rezipient überhaupt nur darauf, mich zu alterieren, also von mir selbst abzusehen, aus mir selbst rauszukommen, oder an den Rand meiner eigenen Wahrnehmung zu kommen, wenn mir etwas offenbart wird, was mich überrascht, wachrüttelt, aus mich selbst rausholt, Beispiel gibt, hast Du gesagt. Ich glaube, insofern ist der Prozess der Bildung, so wie Du ihn beschrieben hast, übertragbar auch auf die Gegenstände, die uns da vermittelt werden. Es sind nicht nur Menschen, sondern es sind auch Inhalte, bei denen es gilt, diesen Heuristikwechsel zu vollziehen, weil wir sonst gar nicht vorankommen, so dass – auch nochmal an Tomasello anknüpfend – dann irrerweise über Generationen von Menschen hinweg Dinge entstehen können, aufeinander aufbauend. Dieser Moment des von sich Selbst-absehen-Könnens spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Damit kommen wir noch einmal zurück auf das, was Du zuletzt genannt hast: Echte, ganzheitliche Bildung wird schlechterdings nicht möglich sein, ohne dass es eine starke Lehrpersönlichkeit gibt. Wenn wir über hybride Formate reden, ist es natürlich noch viel wichtiger, dass ich den Mensch sehe, die Gruppe – darüber haben wir am Anfang geredet – aber auch den einzelnen Menschen als Gegenüber.
Jetzt knüpfe ich nochmal an, um vielleicht einen kleinen ersten Kreis zu schließen, an die Chancenungerechtigkeit. Die ist natürlich längst schon da gewesen, auch vor dieser Verschärfung durch Corona. Alles das, was wir jetzt hochtrabend, abstrakt beschreiben, spielt aus meiner Sicht eine große Rolle für Schultypen und Schulmodelle, die sich solche Dinge bewusst machen, die Bildung nicht abnudeln und runterkauen. Das sind Schultypen, für die ich allerdings die Erkenntnisse vorrausetze, über die wir gerade sprechen, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, mein Kind dorthin zu schicken. Hier in Jena sind wir ja gesegnet mit verschiedenen Ansätzen, mit einer Bildungslandschaft, die auf kommunaler Ebene wirklich sehr besonders ist, weil sie so eine Vielfalt von solchen Ansätzen bereithält. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir hier eine massive soziale Ungleichheit, was die Chancen anbelangt. Welche Familien, welche Kinder gehen in Schultypen reformpädagogischer Natur und haben überhaupt den Zugang bzw. die Erkenntnis, das Wissen, was diese Schultypen ihren Kindern bringen? Da haben wir doch von vorherein schon unterschiedliche Tempi in der Bildungslandschaft. Das lässt mich nahezu verzweifeln, weil die Situation ja schon vor Corona in starkem Maße darin bestand, entgegen dem von uns beschriebenen Bildungsideal einen instrumentalisierten, funktionalisierten Setzbaukasten zu verfolgen, der letztlich dazu dient, Wirtschaft zu befeuern, Wachstum zu erzeugen etc. Ich will das gar nicht weiter ausformulieren, ich denke, es ist sofort klar, wovon ich spreche.
Wie bekommen wir diese Dinge in eine bildungspolitische Übersetzung? Wo und wie beginnen wir Prozesse, die uns dahin bringen, dass wir eines Tages tatsächlich Inklusion vollziehen, um eine Mehrheit von Menschen der Gesellschaft mitzunehmen?
PETER FAUSER: Da geht es mir ähnlich wie Dir. Wenn ich mir die Entwicklung in den letzten 50 Jahren anschaue, sage ich meistens, es hat sich gar nichts verändert, es ist gar nichts geworden. Man kann tausend Mal predigen, es ändert sich überhaupt nichts. Es reproduzieren sich immer die differenzerzeugenden Mechanismen in der Schule. Insgesamt gesehen muss man aber sagen: Wenn man die empirischen, die Bildungsstatistiken anschaut, ist die Chancengerechtigkeit besser geworden. Es gibt immer mehr Kinder, die Schulabschlüsse erwerben, kein Vergleich zu den 1950er Jahren. Da gab es 5 Prozent Abiturienten, heute bekommt die Hälfte eines Jahrgangs eine Hochschulberechtigung. Es gibt also so etwas wie einen demokratisch-humanen Fortschritt.
Zweite Bemerkung: ich habe ja vor vielen Jahren den deutschen Schulpreis initiiert. Der ist angetreten mit der Frage: Wie sieht´s denn aus? Wir wissen, dass die Einzelschulen die entscheidenden Agenturen für Bildungsgerechtigkeit und Lernqualität sind. Wie sieht es da aus, kann man das beschreiben? Kann man eine Art Wettstreit ausrichten, bei dem die besten Schulen gefunden werden, die besten im pädagogischen Sinne? Die Antwort lautet: Die besten Schulen gibt es in jeder Form; die besten Schulen gibt es in allen Bundesländern! Es gibt also eine große Zahl von Schulen, die genau den Spagat hinkriegen, dass sich die Kinder einerseits wohlfühlen, sich gefördert fühlen, und andererseits gleichzeitig ein hohes Leistungsethos herrscht. Es gibt die gute demokratische, es gibt keine gute undemokratische Schule. Das ist eine empirische Tatsache. Bildungspolitik und Strukturpolitik bewegen sich wie eine Schnecke, das ist die andere Wahrheit. Zu dieser anderen Wahrheit gehört auch, dass wir in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung und -fortbildung eigentlich immer noch im 19. Jahrhundert stecken.
Ich habe zehn Jahre lang ein großes Fortbildungsprogramm geleitet, es nennt sich „EULE“ und steht für „Entwicklung von Unterricht und Lernqualität“. Der Kernbegriff beschreibt „verständnisintensives Lernen“. Wir haben den Begriff eines Verstehens zweiter Ordnung ins Zentrum gestellt. Was ist damit gemeint? Ich denke an meinen Kunstlehrer! Verstehen zweiter Ordnung heißt: Ich verstehe einen Gegenstand nicht gleichsam absolut unverstellt, also „an und für sich“, sondern ich verstehe ihn immer auch so, wie Andere ihn verstehen. Pädagogisch kommt es darauf an, diese verschiedenen Wege des Verstehens miteinander in Verbindung bringen, und zwar so, dass die Lernenden davon profitieren. Das ist eine ähnliche Fähigkeit wie in der Psychotherapie die Fähigkeit eines Therapeuten, sich auf die Perspektive und die Emotion des Klienten ganz und gar einzulassen, ohne sich selbst zu verlieren. Das wird aber in der Lehrerbildung nicht gelernt. Es ist im Grunde eine handwerkliche Fähigkeit, das setze ich jetzt ein bisschen gegen Deinen Begriff der starken Lehrerpersönlichkeit und der starken pädagogischen Persönlichkeit. Der Pädagogenberuf ist, soziologisch gesehen, ein Massenberuf. Wir haben gezeigt, dass es eine Frage des Handwerks ist, des professionellen Handwerks, ob man das kann oder nicht, das muss man üben. Es ist nämlich nicht trivial, sich in das Verstehen Anderer hinzudenken. Das ist ein Übungsprozess, weil man praktisch gleichzeitig immer mit mindestens drei verschiedenen Perspektiven jonglieren muss: Mit der eigenen, mit der Perspektive des Gegenübers und mit deren Vergleich. Und das Ganze wird in der Schule natürlich noch komplexer durch die Gruppensituation.
Zum Glück sind wir alle irgendwie Kollektiv- und Gruppenwesen und bringen die Grundvoraussetzungen dafür mit. Aber im Druck der Verhältnisse, im Stress des Schulalltags geht dann einfach wahnsinnig viel verloren. Noch einmal: Diese Fähigkeit, um es mit Deinen Worten zu sagen, von sich selbst absehen zu können, die muss professionell erworben werden. Das ist eine der ganz großen Baustellen im Bildungswesen. Ich kann nur sagen: Seit über 50 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema, und der Fortschritt ist eine Schnecke. Aber es ist nicht hoffnungslos.
JONAS ZIPF: Das ist sehr schön, dass wir diesen hoffnungsvollen Punkt erwischen. Schön finde ich auch, der hat uns jetzt ein bisschen unsichtbar begleitet, zweimal haben wir ihn auch ausgesprochen, dass wir mit dem Begriff der zweiten Ordnung auch noch einmal so eine systemtheoretische Perspektive von Luhmann rein bringen. Da gibt es auf jeden Fall eine Analogie. Das ist natürlich eine spannende Angelegenheit, weil ich auch hier aus mir rauskommen muss, um die Situation gewissermaßen von außen zu betrachten. Das lässt sich – da bin ich bei Dir – handwerklich machen, also technisch.
PETER FAUSER: Das ist nicht trivial.
JONAS ZIPF: Nein, es ist nicht trivial. Dafür braucht es tatsächlich – weil es eben nicht trivial ist – entsprechende Ressourcen. Sprich: Es muss in der Ausbildung eine Rolle spielen, es muss auch in der Zeitplanung im täglichen Ablauf eine Rolle spielen. Das wäre etwas, was ich auch sehr spannend fände, nochmal in Anschlag zu bringen für die Kultur, im Übertrag. Gerade weil Du auch davon gesprochen hast, dass uns quasi die beispielgebenden Mentoren begleiten. Ich glaube, das können viele Künstler:innen von sich auch sagen, in vielen Fällen, die ich kenne, die solche prägenden Persönlichkeiten für sich erlebt haben und nun ebenfalls mit mentalen Bildern arbeiten können: auf eine dritte Ebene gehen und von außen draufschauen können oder sie unsichtbar begleitende Menschen bei sich wissen. „Was würden die jetzt sagen, was würden die jetzt machen in der aktuellen Situation?“ Das ist eine ganz, ganz entscheidende Komponente, wenn wir über Bildung reden. Das gilt auch für den künstlerischen Prozess. Es ist schön, dass wir den hoffnungsvollen Schlenker an der Stelle kriegen. Gleichzeitig schaut da wieder der andere unsichtbare, sichtbare Begleiter unseres Gesprächs – Tomasello – um die Ecke. Denn natürlich sind das riesige zeitliche Schritte, über die wir hier sprechen. Und Du sagst, der bildungspolitische Fortschritt sei eine Schnecke. Aber er ist da, und messen wir es jetzt nochmal in Kategorien eines Evolutionsbiologen, dann geht es doch sogar vergleichsweise relativ schnell. Oder?
PETER FAUSER: Ja, ja. Aber man weiß nicht, wer schneller wächst: Die Einsicht oder der Trumpismus, die Tunnelung durch Echokammern oder der öffentliche Raum? Das ist ja ein ständiger Kampf. Das haben wir ja bei Habermas‘ Modernisierungs-Theorie: Der beschreibt ja genau diesen Wettstreit, ob wir es mit der Kolonialisierung der Lebenswelt zu tun haben oder mit der Rationalisierung der Systeme. Das ist unentschieden. Gut, ich meine, das ist schon wieder trivial, was ich sage, das hat ja der alte Freud auch schon gesagt: Es ist unklar, wer siegt.
JONAS ZIPF: Naja, aber immerhin ist es vielleicht noch ein offenes Rennen. Ich sag es mal so: Wenn Habermas noch mal 90 Jahre leben würde, würde er vermutlich in den nächsten Jahrzehnten ganz viel und insbesondere zu den Social Media forschen. Das hat er ja erst am Ende noch ein bisschen, wie am Rande, in Betracht gezogen. Es geht doch darum, die Errungenschaften des öffentlichen Diskurses zu tradieren und weiter zu spinnen. Genau dasselbe gilt jetzt, glaube ich, für unser Gespräch. Ich versuche einmal, wenigstens auf die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung zu steigen und uns von außen zu betrachten: Wir haben jetzt eine knappe Stunde gesprochen, an einem Tag, an dem wir aus dem Fenster schauen und draußen ist alles weiß, eingeschneit; mein Sohn hat uns am Anfang akustisch gestört, das kann man hoffentlich auf dem Diktiergerät alles nachvollziehen, ist dann aber eingeschlafen und liegt mittlerweile in seinem Bettchen hier. Das sind genau die Wesen, die Kleinen, um die es geht bei alledem, was wir hier besprechen. Letztlich wird es natürlich auch darum gehen, was machen die Anderen mit dem, was wir zum Beispiel jetzt ausgetauscht haben.
PETER FAUSER: Ja. Das ist ja wichtig und sehr schön. Ich würde – wenn Du einverstanden bist – gestern hatten wir ja gelben Schnee, Ihr auch? — mich hat das natürlich sofort zu einem Sonett veranlasst – mit dem würde ich schließen, wenn Du einverstanden bist?
JONAS ZIPF: Sehr gern. Aber bevor Du das zum Besten gibst: Wir hatten erst große Angst bei dem gelben Schnee und dachten: „Mein Gott!“ Aber dann hat uns jemand gesagt: „Nee, es sei einfach Sahara-Sand!“ Ist das so?
PETER FAUSER: Ja, es ist so. Aber Du kennst auch den Gebirgsjägerwitz, oder?
JONAS ZIPF: Nein.
PETER FAUSER: Was lernen die Gebirgsjäger als erstes? …. Keinen gelben Schnee essen!!!!!
Sonett: Schnee, sonnengelb
Gelb schien der frisch gefall’ne Schnee zu sein.
Ein Gelb wie von den ersten Winterlingen,
Die jetzt schon durch die weiße Decke dringen.
Vielleicht, dacht‘ ich, ist es der Sonnenschein,
Dass er der kalten Macht ein wenig leiht
Vom Goldglanz ewig neuer Frühlingsfülle;
Ein zartes Klingen in der Winterstille,
Ein Seelentrost, denn Ostern ist noch weit.
Doch nichts von alledem, es ist nur Sand.
Aus der Sahara übers Meer geweht.
Kommt häufiger, weil sich das Klima dreht.
Die Winde haben wir nicht in der Hand,
So wenig wie die Viren. Auf jeden Fall
Sind sie aktiv, schon da und überall.
——————————————————
JONAS ZIPF: Vielen Dank für dieses Gespräch.
PETER FAUSER: Danke, Dir auch.

Dr. Peter Fauser war bis 2013 Professor für Schulpädagogik und Schulentwicklung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Nach dem Lehramt für Grund- und Hauptschulen (Musik und Mathematik) sowie einem Diplomstudium der Erziehungswissenschaft folgten Promotion und Habilitation an der Universität Tübingen. Fauser war Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs Förderprogramm Demokratisch Handeln und des Thüringer Entwicklungsprogramms für Unterricht und Lernqualität. Er initiierte 2005 den Deutschen Schulpreis und war mehrere Jahre Sprecher der Jury.
In Jena ist er als Mit-Initiator der Imaginata, die er zusammen mit seiner Frau Gundela Irmert-Müller gegründet und aufgebaut hat, vielen ein Begriff. Das Paar hat vier Kinder und neun Enkelkinder und wohnt in Großlöbichau. Eines seiner Hauptinteressen gilt der Demokratieerziehung in der Schule, weniger durch Fachinhalte als durch demokratische Strukturänderungen und Mitbestimmung der Schüler in einer gelebten Demokratie.
Auch darum geht es in unserem heutigen Blogbeitrag! Diskutieren Sie mit!