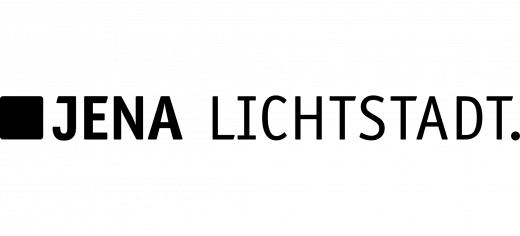Corona, Smartphones, Fußball und die Frage der Bedingungslosigkeit
Auf einen Kaffee und eine Zigarette wollten die Beiden sich schon des längeren treffen: Immer wieder fehlten dem Münchner Soziologen und dem Jenaer Kulturverantwortlichen aber dafür die Zeit. Nun ermöglichen Corona und Babypausen auf beiden Seiten zwar wenigstens etwas Zeit, dafür bleiben aber die Reisemöglichkeiten zwischen München und Jena eingeschränkt. Ein kurzes Telefonat kam dennoch zustande: Ein schnelles, ein eiliges, ein intensives Gespräch. So, wie es sich für eine echte Kaffee- und Zigarettenpause eben gehört, wenn auch virtuell: Was also haben Corona, Smartphones, Fußball und das bedingslose Grundeinkommen miteinander zu tun? – Alles eine Frage des Leidensdrucks finden Stephan Lessenich und Jonas Zipf…
JONAS ZIPF: Hallo Stephan. Hier Jonas. Sorry, dass ich so spät bin. Jetzt haben wir schon mal eine Stunde. Und dann klau ich uns gleich noch 15 Minuten…
STEPHAN LESSENICH: Hallo Jonas. Alles gut. Müssen wir halt schneller sprechen.
JONAS ZIPF: Schön jedenfalls, dass es jetzt klappt. War ja gar nicht so leicht, Dich zu erreichen. Aber jetzt weiß ich ja, dass Deine Tochter Dein Handy verlegt hat. Wie heilsam!
STEPHAN LESSENICH: Ja, das finde ich tatsächlich. Und so wirklich habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht um Ersatz bemüht. Ich finde das wirklich gut, so aus der Welt zu sein…
JONAS ZIPF: Das Diktiergerät läuft jetzt jedenfalls. Das ist ja vielleicht noch der bessere Teil dieser Teile. Diese kleinen schwarzen Dinger werden ja oft als digitale Schweizer Taschenmesser bezeichnet, mit all ihren Funktionen. Aber ich bin komplett bei dir. Was mich insbesondere extrem abfuckt, ist diese ständige Überwachung, wenn man die entsprechenden Möglichkeiten dieser Geräte nutzt: Deswegen schalte ich regelmäßig Bluetooth und die mobile Datennutzung aus. Aber eigentlich müsste ich konsequenterweise auch ganz darauf verzichten. Das wäre besser. Ich habe das in anderen Bereichen geschafft. Social Media gibt es seit Jahren nicht mehr bei mir. Ein privates Handy habe ich nicht mehr, nur noch ein Arbeitshandy. Aber für die Taktung und Verdichtung von Arbeit, so wie ich sie kenne, erscheint ein Smartphone vermeintlich unverzichtbar. Vermeintlich…
STEPHAN LESSENICH: In der Wissenschaft sagen die Leute das auch, eigentlich unverzichtbar. Um wirklich kurzfristig reagieren zu können, oder eben auf dem Laufenden zu sein, oder überhaupt in bestimmte Dinge Einblick zu haben, also bestimmte Felder, Diskussionen, Bewegungen usw… Das verdichtet sich jetzt noch in der Frage der Corona-App: Wer kein Smartphone hat, macht sich sozusagen verdächtig, dass er nicht teilhaben möchte an der Sicherung der Volksgesundheit. Von daher hat das jetzt nochmal eine ganz andere Dimension erhalten.
JONAS ZIPF: Genau. Und die Apps funktionieren ja allesamt nur, wenn ich online bin. So sicher die Corona-App datenschutzseitig auch zu sein scheint, dennoch muss ich Bluetooth anschalten, muss ich sichtbar sein für andere. Auch, wenn das tatsächlich komplett anonymisiert läuft, ist das schon so eine sinnbildliche Verdichtung, ein echtes Dilemma. Einerseits entsteht ein begründbarer sozialer Zwang, andererseits brauchen wir die Überzahl der Anwendungen nicht essentiell. Die sind doch eher eine Stimulation von Bedürfnis. Also, da könnten wir jetzt über bzw. mit Marx reden oder der Frankfurter Schule. Dass wir diese Geräte brauchen, ist am Ende genauso wenig wahr wie, dass irgendjemand als individuelle Arbeitskraft jemals unverzichtbar wäre. Es gibt immer andere Möglichkeiten.
STEPHAN LESSENICH: Ja, also ich finde das ist ein gutes Beispiel für die soziale Konstruktion von Realität. Es erinnert mich daran, was mir in meiner Lebenswelt immer wieder auffällt: Wie sämtliche Leute, die an der Uni beschäftigt sind, sich wechselseitig versichern, wie krass die Arbeitsbelastung geworden ist und dass man nicht mehr hinterherkommt und was man noch alles machen muss bis spätestens morgen, eigentlich aber gestern… Dabei sind wir da immer in einer Doppelrolle. Also, den Leuten, von denen ich selber irgendwelche Texte einfordere, schreibe ich, dass ich die Texte, die sie von mir einfordern, gerade nicht liefern kann. Das heißt, man bewegt sich auf beiden Seiten. Alle sind sozusagen auf allen Seiten Partei und treiben das Spiel irgendwie wechselseitig mit an und vergewissern sich einander, dass das Spiel Kacke ist, aber dass es dennoch unbedingt weitergespielt werden muss. Es ist bei allen möglichen Belangen, glaube ich, so, dass diese sozialen Mechanismen so gut funktionieren, dass man individuell für sich überlegt: Mensch, eigentlich möchte ich dieses und jenes nicht mehr mitmachen, aber die soziale Bestätigung und Verstärkung, die es durch Interaktionen gibt, übrigens immer gefühlt notwendige Interaktionen, die halten das Ding dann halt doch am Laufen. Schon eine Paradoxie muss man sagen.
JONAS ZIPF: Die Zeit ist ja voller Paradoxien. Wir laufen jetzt gerade Gefahr, dass wir springen, aber das macht jetzt gerade so viel Spaß, deswegen spreche ich meine Assoziation einfach aus: Du bist ja auch per se erstmal ein Fußball-begeisterter Mensch, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, wie es Dir geht: Aber für mich spitzt Corona ein Dilemma zu, das schon vorher da war. Und das ist ziemlich gut vergleichbar mit dem, was Du beschreibst, strukturell. Wir sind aber offensichtlich noch nicht wirklich an dem tiefen Punkt der Krise angelangt, an dem wir wirklich bereit wären, mehrheitlich eine Transformation zu wagen. Also, die Fortsetzung der Bundesligasaison ist ja strukturell derselben Argumentation gefolgt. Das musste sein, es muss eben sein. Weil sonst quasi ein ganzes System aus dem Tritt kommt. So. Eigentlich ist es aber die perfide Zuspitzung eines Unbehagens, das ich als Fan schon ganz lange spüre. Noch offener und transparenter kann man nicht demonstrieren, dass es nur noch ums Geld geht, als letztlich ohne Fans zu spielen.
STEPHAN LESSENICH: Ich habe einen Freund, der hat sich schon seit Jahren ausgeklinkt. Der hat mir immer gesagt: Das ist so Scheiße, es geht nur ums Geld. Der hat im Grunde genommen schon vorher gesagt: Das muss am Laufen gehalten werden, es ist ganz egal, wer zuguckt oder nicht, Hauptsache, es wird simuliert, dass es dafür Interesse gibt. Und das ist jetzt so offensichtlich geworden. Ja, mir geht es ähnlich. Ich bin ja auch da selber Partei und leide gerade eigentlich kräftig mit Werder. Gleichzeitig gilt: Obwohl ich mir eigentlich sonst alles angeschaut hätte, das Gefühl gehabt hätte, ich muss es mir anschauen, habe ich mich auch da ausgeklinkt. Es ist da für mich tatsächlich nochmal schonungslos offensichtlich geworden, dass Fußball ein selbstbezügliches System ist, das – koste es, was es wolle – durchgezogen werden muss. Da fragt man sich als Fußballinteressierter, als fußballbegeisterter Mensch: Was ist hier eigentlich los? Wie kann es sein, dass so ein gesellschaftliches Feld, das im Grunde völlig überflüssig ist, sich so aufspielen kann? Damit sind wir dann auch bei der Frage nach der Ökonomie des Notwendigen: Fußball ist vollkommen verzichtbar, strahlt aber eine gesellschaftliche Relevanz und sogar eine Relevanz in unserem persönlichen Leben aus, die dazu führt, dass es sozusagen als „too big to fail“ erscheint. Völlig verrückt.
JONAS ZIPF: Too big to fail. Also, ich habe mir mal überlegt, so für mich, wie das wäre als Theatermann? So fühle ich mich ja immer noch, auch wenn ich jetzt gewissermaßen die Seite in Richtung Kulturpolitik gewechselt habe. Wenn wir als Theaterleute, so wie wir staatlich finanziert sind, die staatliche Finanzierung nur behalten könnten, indem wir spielen, aber ohne Zuschauer spielen, dann wäre das so ungefähr das gleiche, vielleicht wären Kameras dabei, klar, die Leute könnten über Skype zuschauen. Aber wir würden praktisch erklären, dass es uns egal ist, ob Publikum kommt oder nicht. Wir würden erklären, dass wir das machen, weil es systemimmanent wichtig ist, zu spielen. Du hast das gerade „selbstreferenziell“ genannt, übrigens ein klassischer Vorwurf an die Kunst. Wir wären uns selbst genug, wir nähmen uns sehr wichtig, wir hätten den Bezug dazu verloren, was in der Gesellschaft um uns herum los ist, was wichtig und relevant ist und was nicht. Auch an dieser Stelle komme ich dann zu dem Schluss, dass wir ganz offensichtlich innerhalb dieser Krise noch nicht am tiefsten Punkt des U, oder wie auch immer sich der Verlauf von Krise und Selbsterkenntnis in ein Bild, in eine Metapher gießen ließe, angelangt sind, um an so einen Leidenspunkt zu kommen, dass wir so was, eine solche Verhaltensweise, dann auch wirklich bleiben lassen. Beim Fußball machen immerhin noch – oder besser: wieder – Millionen an ihren Bildschirmen mit. Du und ich vielleicht nicht, ich habe das jetzt auch boykottiert, wir haben diesen schmerzlichen Punkt beim Fußball schon jahrelang berührt. Ich habe mich ganz lange schal gefühlt, es hat nicht mehr den gleichen Spaß gemacht, es ist schon fast ein nostalgisches Element mit Erinnerung an die Kindheit geworden. Ich habe aber trotzdem immer mitgemacht. Und sei es nur, dass ich in die Kneipe gegangen bin und mir die Spiele dort angeschaut habe. Ich habe das mitgetragen und dadurch beglaubigt und auch mit dazu beigetraten, dass das System Geld umsetzt. Jetzt ist da für mich ein toter Punkt erreicht. Und das nicht nur aus einer politischen Überzeugung, zu der man sich selber zwingt, sondern ich habe wirklich keine Freude mehr daran. Selbst, wenn ich es mal ausprobiert habe und doch reingeguckt hab, dann merke ich, das hat sich innerlich entfernt. Bei ausreichend vielen Anderen aber ganz offensichtlich noch lange nicht…
STEPHAN LESSENICH: Ja, also da kann man ja auch nur hoffen, dass sich die anderen gesellschaftlichen Felder ähnlich demaskieren, mit ihren Infantinos, ihren Scheichs und ihren kriminellen, mafiösen und sonstigen Strukturen. Und Du hast vollkommen recht. Auch hier bleibt es ein Punkt des inneren Widerspruchs. Mir war das lange genug klar, aber ich bin weiter vollkommen drauf abgefahren. Aber irgendwann muss man sich doch mal fragen: Wie kann es eigentlich sein, dass ich auch emotional, affektiv so verstrickt bin in eine Struktur, von der ich – wenn ich nur mal kurz einen Schritt zurücktrete – sehe, dass sie völlig destruktiv ist!?
JONAS ZIPF: Ja, das ist jetzt bei dir der Fall und bei mir auch, aber Demaskierung hat offensichtlich noch nicht dazu geführt, dass sich eine Masse abwendet. Das Absurde ist, die Masse ist sich dessen sogar bewusst, sie sieht die Demaskierung. Also, es gibt ja durchaus Bewegung in der Vereinsszene, es gibt eine große Diskussion, die sich in den Leitmedien abbildet. Sowas wird im Aktuellen Sportstudio aufgegriffen und sonst wo. Aber es bleibt dabei, dass offensichtlich sehr viele, auch von denen, die es kritisch sehen, trotzdem noch zuschauen. Und auch ihr Pay-TV-Abo wahrscheinlich verlängern. Also, die Einschaltquoten sind ja exorbitant. Und das ist wirklich strukturell vergleichbar mit dem Hamsterrad, das du beschrieben hast, in der Arbeitswelt: Ich brauche diese Geräte. Ich weiß, es ist schlecht für mich, ich beklage die Beschleunigung, die Arbeitsverdichtung und komm trotzdem nicht raus.
STEPHAN LESSENICH: Dann vergleich das mal mit – sagen wir es großspurig – der Demokratie, von der man jetzt sagen könnte, wenn man den Rechtspopulismus sozusagen als Indikator einer sozialen Problematik erkennt oder wenigstens, dass wir mit einer entsprechenden gesellschaftsstrukturellen Problematik leben müssen: Für die Leute, die sich da vom Politikbetrieb in einer Weise abgewendet haben, die dann eben auch destruktiv wird, für deren Wahrnehmung hat sich der Politikbetrieb ganz genauso demaskiert. Sie empfinden es so: Dass es nicht um sie geht, dass es um alles Mögliche geht, dass es ein selbstreflexiver und selbstbezüglicher Betrieb ist, der macht, was er will. Da wimmelt es nur so von Infantinos, da ist der Betrieb durch und durch korrupt usw. Und ich glaube, viele „normale“ Bürger und Bürgerinnen teilen vielleicht einen nicht affektiven Kern dieser Diagnose, nämlich die Ansicht, dass da was schief läuft und dass es da tatsächlich eine Entkopplung von gesellschaftlichen Willensbildungsprozessen und auch von gesellschaftlichen Einstellungen gibt und dass der Betrieb so vor sich hin prozessiert, und trotzdem machen alle weiter mit. Das hieße dann: In die Fußballkneipe gehen, das ist halt wie zur Wahl gehen. Wir wissen es vermeintlich besser, machen aber nichts anders. Schon wieder eine Wahl? Schon wieder vier Jahre vorbei? Naja, so richtig weiß ich auch ja nicht, wen wählen, und irgendwie läuft alles nicht so gut, aber klar mach ich mit, muss man ja auch. Ich bin ja Staatsbürger / Staatsbürgerin und mündig und möchte mich natürlich wenigstens an den Punkten, bei denen ich überhaupt mitreden kann, beteiligen. Also ich finde, die Demaskierungen sind doch weiter vorangeschritten, und ich glaube auch, dass oft der Normalbürger / die Normalbürgerin irgendwann das Gefühl hat, hier ist irgendwie was nicht in Ordnung und da liegen irgendwo Leichen im Keller.
JONAS ZIPF: Das verstehe ich: Aber gleichzeitig ist das ja eine regelrechte Abspaltung. Es finden doch nicht alle von denen, die diese Demaskierung erkennen – die den in Deinem sehr guten Vergleich, Deiner Übertragung auf die Demokratie, empfundenen Widerspruch erleben –, dass dieses System per se abgeschafft gehört. Wenn sie gefragt werden, welche Alternative es gäbe, dann sagen sie, es ist immer noch die beste aller Welten oder das kleinste Übel oder der kleinste gemeinsame Nenner oder welche Formulierung oder welches Bild man auch immer findet – und das ist eigentlich, finde ich, das Schlimme daran. Dass es eine gefühlte Ohnmacht gibt – also, eigentlich liebe ich den Fußball, und es gibt auch nichts Besseres oder nichts Anderes und trotzdem ist es nicht gerade schön, in diesen Zeiten Fußballfan zu sein.
STEPHAN LESSENICH: Das ist wirklich so, also, ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, man könnte aber bei allem, was du jetzt gesagt hast, Fußball durch Demokratie ersetzen. Weil ich meine, du hast eine Vorstellung davon, wie Fußball eigentlich sein soll, und früher war er so, damals, auf den kleinen Plätzen, ohne viel Geld im System, da ging es um das Eigentliche. Sieg-Niederlage-Gemeinschaft, zusammen da durch, sich mit dem eigenen Verein identifizieren, egal, was passiert. Man könnte ja auch sagen, das gilt ja auch für die Demokratie. Da sagen die Leute, eigentlich eine super Idee, früher, es war vielleicht auch irgendwie responsiver, man war näher dran, die haben einen mehr gefragt oder haben vielleicht sogar mehr gedacht, dass sie irgendwas für einen selbst machen und nicht nur für sich. Das ist alles verloren, es gibt ja auch solche retrospektiven Idealisierungen – ja früher, da war die Demokratie besser, genau wie der Fußball früher irgendwie noch ehrlich und bodenständig war. Also ich finde schon, dass man, ohne es zu überziehen, das tatsächlich parallelisieren könnte, wenn man es drauf anlegen würde.
JONAS ZIPF: Ja, das wird natürlich am Ende wahrscheinlich ein wirklich hinkender Vergleich, wenn man es analytisch in die Tiefe treibt. Aber was daran erschreckend ist, ist doch, dass offensichtlich nur die nostalgische Perspektive auf die Vergangenheit bleibt. Also, das ist das, was ich jetzt versucht habe, mit dem Begriff der Ohnmacht zu fassen: Dass keinerlei Alternative daneben oder in der Zukunft existiert, deren Sexiness oder Anziehungskraft ausreichen würde, um uns von dieser Nostalgie, von dieser Ohnmacht, abzubringen. Das ist ja wie eine Lähmung, auch der politischen Linken als urtümlich progressiver, treibender Kraft, gesellschaftliche Entwürfe, staatliche Entwürfe als Alternativen zum Status quo zu denken. Das ist doch Wahnsinn, dass wir dann lieber in eine Regression verfallen. Das Einzige, was uns im Prinzip noch bleibt, ist zu sagen „Früher war es besser“, in der einen oder anderen Form. Ob es jetzt die Bonner Republik ist, die noch so gemütlich und so direkt war, in der die Parteien-Demokratie noch funktionierte, in der Parteien als Volks-Parteien noch echte Querschnitte durch die Bevölkerungsschichten waren. Ob es die Nostalgie in Richtung DDR ist, wo man sich noch näherstand als Kleinbürgertum und sich wenigstens noch informell unter der Hand gegenseitig geholfen hat und es noch einen unverstellt solidarischen und direkten Kontakt zueinander gab. Das ist ja beim Fußball genauso, das sind alles nostalgische Momente, die wir formulieren, letztlich zu einem Großteil vergangenheitsbezogene Projektionen.
STEPHAN LESSENICH: Ja, ich glaube, weil wir alle irgendwie so disponiert sind, dass wir hoffen, dass irgendwann irgendwo jemand um die Ecke kommt, entweder der Führer oder eine Partei oder ein großer Intellektueller, irgendwie ein Gesamtdenker – natürlich ein Mann, was sonst -, der uns erzählt, was jetzt die Alternative wäre, wie es aussehen könnte und welche Schritte man dahin gehen müsste. Und der am besten noch einen Masterplan entwirft. Und mir 10 Schritte auf dem Weg zur Transformation beibringt, die ich selber in meinen Alltag einbauen kann. Bei aller Kritik an der repräsentativen Demokratie, wir leben nun einmal in einer Delegationsgesellschaft. Wir hoffen, dass die Anderen etwas für uns tun, und wenn sie das nicht machen, dann projizieren wir auch noch den Frust über uns selbst auf die Anderen. Manchmal wird dann daraus sogar Aggression. Das war früher auch nicht anders. Wir denken jetzt zwar, früher gab es den Sozialismus oder irgendwelche anderen gut ausgemalten Alternativen, Programme und Programmatiken … – aber ich glaube, dass es irgendwann früher auch nicht einfacher war. Früher haben die Leute was geändert, wenn sie was ändern wollten oder wenn sich etwas ändern musste – im Endeffekt haben es die Leute einfach gemacht. Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass man endlich aufhören müsste, darauf zu warten, dass irgendwo von irgendwoher der Heiland oder Heilsverkünder kommt, sondern dass wir uns idealerweise gemeinsam oder meinetwegen wenigstens ich mir allein überlegen müsste: “Naja, was läuft denn politisch und gesellschaftlich schief? Was kann ich selbst anders machen? Wo liegen meine Ressourcen und Kompetenzen? Was sind meine Optionsräume? Wo kann ich etwas ändern, wo nicht?“ – Und da, wo ich zu einer Änderung beitragen kann, versuche ich nach Kräften, das zu tun.
JONAS ZIPF: Das klingt jetzt ein bisschen nach „Wort zum Sonntag“, dem alten Gassenhauer der Toten Hosen: „Früher war alles besser – Früher war alles gut – Da hielten alle noch zusammen – Die Bewegung hatte noch Mut. Früher, ach hör auf mit früher – Ich will es nicht mehr hören – Denn damals war es auch nicht anders – Mich kann das alles nicht stören“. Aber ich komm jetzt mal mit einer anderen Assoziation, mit einem psychologischen Bild um die Ecke. Ich lese gerade „Hotel Abgrund“ von Stuart Jeffries, eine, wie ich finde, gelungen schöne Geschichte der Frankfurter Schule – kennst du vielleicht?
STEPHAN LESSENICH: Das ist geil, du musst… – also freu dich auf die letzte Seite, da werden Dörre, Lessenich, Rosa als die Wiederbeleber der kritischen Theorie gelobt.
JONAS ZIPF: Da wäre jetzt die große Frage, ob du das als Ritterschlag empfindest…
STEPHAN LESSENICH: Ich finde es schlimm, dass Rosa und Dörre auch dabei sind.
Beide lachen
JONAS ZIPF: Also, wenn ich die Kontinuität der Frankfurter in der Folge von Marx nachvollziehe, dann hinterfrage ich mehr und mehr die zugrunde liegenden Axiome und Konstrukte: Aus dem Marxismus heraus redet man z. B. über Entfremdung. Das unterstellt ja implizit, es hätte einen Zustand gegeben, einen naturwüchsigen, in dem Arbeit nicht entfremdet gewesen wäre. Das ist fast schon so eine Rousseausche Denkweise, eine Idealisierung eines paradiesischen Urzustands. Da könnten wir jetzt weit in die Tiefe gehen, da werde ich dir auch kaum folgen können. Mein Punkt lautet: Nie wird die Prämisse der Fortschritts-Geschichte hinterfragt; möglicherweise aber war der Zustand vor der Entfremdung kaum weniger entfremdet, sondern einfach nur unbewusst. Menschen haben gearbeitet und sich einfach gar nicht so viel Gedanken darüber machen können, wie sich das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeit und Selbstverwirklichung anfühlt. Mir kommt vieles von dem, was wir jetzt diskutiert haben, ähnlich vor. Deswegen komme ich mit der Psychologie um die Ecke. Vielleicht ist die Bewusstwerdung ein wesentlicher Bestandteil des Problems. Heute steht uns eine lange Geschichte mit all ihren Möglichkeiten ständig zur Verfügung, wir haben die in petto. Wir können auf alles zurückschauen und kennen einen riesigen Möglichkeitsraum, der uns so traurig macht, geradezu pessimistisch und verzagt werden lassen muss, weil wir ja immer Vergleiche anstellen und auch ganz viel in diese anderen Epochen und Zeiten und auch anderen Kulturen hinein projizieren können. Es gibt diesen anthroposophischen Philosophen George Steiner, mit seinem Buch „Warum Denken traurig macht“. Darin ein ganz simpler Gedanke, der besagt, wenn man alle Möglichkeiten, die man hat, in seinem Kopf irgendwo hinzureisen, sich was vorzustellen, Utopien zu entwickeln, zu träumen, wenn man die alle als Mensch vor sich sieht, dann kann man nur traurig sein und verzweifeln, weil man diese Fülle niemals erreichen kann. Das könnte man genauso umdrehen und sagen, das ist vielleicht auch gerade schön, es hilft uns, uns auf uns selbst und das, was wir wirklich wollen, zu konzentrieren. Das würde Hartmut Rosa sicher stark machen. Aber bezogen auf das Geschichtsbewusstsein, das wir hier gerade ausbreiten, unterstellen wir doch immer wieder, es gäbe Zustände und Aggregate zu anderen Zeiten, ob in der Vergangenheit oder der Zukunft, an anderen Orten, in anderen Gegenden auf der Welt, in denen es besser gewesen sein könnte. Nach dem Motto „Nachbars Kirschen sind immer röter“. Wenn ich aber überhaupt kein Bewusstsein dafür ausbilden kann, mir überhaupt keine Gedanken machen kann, wenn ich überhaupt keine Zeit, keine Ressourcen als Gesellschaft, keine Leute beschäftigen und bezahlen kann, so wie dich in der Wissenschaft oder mich für die Kultur, die sich überhaupt darüber Gedanken machen, die an einem Donnerstagmorgen, zwischen 9 und 10 Uhr telefonieren und so ein Gespräch führen, dann entsteht vielleicht dieses Schmerzbewusstsein gar nicht erst.
STEPHAN LESSENICH: Ich meine, was haben wir denn die letzten Jahrzehnte gemacht, als Gesellschaft, als Steuerzahlergemeinschaft? Wir haben Leute wie dich und mich finanziert. Wir sind ja nicht erst plötzlich in den letzten Jahren auf die Bühne getreten. Da gibt es so etwas wie Reflexionsagenturen der Gesellschaft. Wir sprechen von Institutionen der Kunst und Kultur, der Wissenschaft, auch der Medien, etwa des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die sind ja in Deutschland, muss man sagen, vergleichsweise auch immer noch gut finanziert, Doch eigentlich ist so ein Selbstreflexionsbetrieb der Gesellschaft vielleicht auch nur einer, der punktuell mal ein, zwei Verkrustungen aufbrechen kann und ein bisschen Licht in dieses Dunkel, das du gerade jetzt rekonstruiert hast, bringen kann, aber der letztendlich nichts austrägt. Kurzum, solange es spezialisierte Agenturen sind, solange keine institutionellen Vorkehrungen der breiten und offenen Teilhabe getroffen werden, solange also Hinz und Kunz, in einem beschissenen Job oder in einer aufreibenden Arbeit oder in einer anstrengenden Familie oder in einer kleinen Wohnung stecken, was auch immer – solange werden sie sich also nicht solche Gedanken machen können. Und die Leute sind nicht doof, die haben nur einfach strukturell beschränkte Mittel, um ihr Nicht-Doof-Sein auch auszuleben. So kommt es dann halt zu Zuständen wie wir sie jetzt haben. Da ist einerseits bestimmt ein psychologischer Mechanismus, aber andererseits, glaube ich, geht das noch tiefer. Das ist gesellschaftsstrukturell – ich habe ja da eben mal aus dem Handgelenk von der Delegationsgesellschaft gesprochen. Es hilft doch auch letztlich, wenn man so die Veränderungsutopien nach hinten projizieren kann: Früher war es besser, unentfremdeter, solidarischer, gemeinschaftlicher, die Leute haben aufeinander geachtet. Das hilft doch dabei, um nicht jetzt etwas tun zu müssen. Es ist einfacher, das Bessere in der Vergangenheit zu vermuten und nach vorne nur pessimistisch zu denken: „Nö, ich habe einfach zu viel zu verlieren, ja selbst in meiner abhängigen Position, kann zwar keine großen Sprünge machen, aber immerhin könnte ich auch das noch verlieren“. Ich glaube, in einer ganz anderen Weise, als das jetzt Heinz Bude mit seiner „Gesellschaft der Angst“ meint, sind solche angstbesetzten Mechanismen tiefenwirksame Verhinderer der strukturellen Transformationen, die eine wirkliche Veränderung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse anbelangen müssten.
JONAS ZIPF: Das, glaube ich, berührt jetzt den Punkt, über den ich heute konkret mit dir reden wollte, nämlich die Frage nach der Arbeit und wie wir quasi Arbeit, Erwerbstätigkeit und die Belohnung und Anerkennung von Arbeit formieren und entkoppeln. Das Gespräch, das ich mit Thomas Oberender geführt habe, dem Intendanten der Berliner Festspiele, das ging ganz schnell in die Richtung, wie jetzt dem Kreativsektor zu helfen sei. Das ist jetzt der Zeitpunkt, um über Modelle wie das Bedingungslose Grundeinkommen zu reden. So könnte man ja auch eine Abzweigung nehmen von dem Strang, den wir jetzt gerade erwischt haben: Solche Modelle sind ja erst möglich geworden durch die Reflexionsagenturen, auch die damit verbundene Traurigkeit, letztlich auch durch die Angst, von der Du gesprochen hast, von der Bude herkommt. Solche Modelle konnten auch entstehen, weil wir so produktiv geworden sind in der Arbeit, weil Zeit freigesetzt wurde bei den Menschen. Wir brauchen heute letztlich einen anderen Arbeitsbegriff. Jetzt könnte das natürlich auch ein Instrument sein, um die Krise zu bewältigen. Beispielsweise gibt es eine Petition aus dem Modedesign heraus, hast du vielleicht mitbekommen: Tonia Merz, das ist eine Modedesignerin, die das auf den Weg gebracht hat, und die mittlerweile über eine halbe Millionen Unterschriften dafür gesammelt hat, das bedingungslose Grundeinkommen jetzt einzuführen, dann aber für die Kreativschaffenden. Das Schwierige an der Diskussion scheint zu sein, dass dieses Instrument vermeintlich nur gelingen kann, wenn man es für alle einführt. So sieht das auch Thomas Oberender, der ganz klar gefordert hat, das soll kein Instrument sein, um jetzt die Krise der Kreativschaffenden zu bewältigen. Stattdessen müssen wir die Krise jetzt nutzen und über die Einführung dieses Instruments insgesamt reden und nicht nur im Bereich der Kreativschaffenden, sondern gesamtgesellschaftlich. Demgegenüber gibt es die gewerkschaftliche Position, die besagt, das BGE sei problematisch, denn es hebele das Recht auf Arbeit aus, es hebele die kollektivrechtliche Gestaltung von Tarifverträgen aus, am Ende sollten wir lieber über eine Reform der Sozialkassen reden, Stichwort Bürgerversicherung und dergleichen. Gerade DGB-Chef Reiner Hoffmann steht dem BGE ja sehr kritisch gegenüber, was einen – finde ich – wundert, also mich wundert es nach wie vor. Findest du auch, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt ist, so ein Instrument rauszuholen, ich will jetzt nicht sagen, aus der Mottenkiste, da befindet es sich nicht, aber es ist auch nicht so, dass es wirklich ernsthaft diskutiert würde, dass man jetzt irgendwo absehen kann, dass es tatsächlich über eine Partei eingeführt werden könnte. Ist jetzt der Zeitpunkt wo man sowas aktiv einfordern kann oder sogar muss? Momentan resultiert die Diskussion ja wirklich eher aus einer Bedarfssituation…?
STEPHAN LESSENICH: Ich habe ja vorhin schon die Ökonomie des Notwendigen angesprochen. Wenn Corona je irgendwie ein Möglichkeitsfenster öffnet, jedenfalls erstmal eine Diskussion über ein so wichtiges Thema zu führen, dann ist das doch gut! Denn das ist ja die Voraussetzung vor allem anderen, eine gesellschaftliche Debatte darüber, was wir eigentlich brauchen und was wir nicht brauchen. Es gibt bestimmte Infrastrukturen, die braucht man einfach für das friedfertige Funktionieren einer Gesellschaft. Wir wissen mittlerweile, dass ein ordentliches Gesundheitswesen dazu gehört, man braucht auch sonstige Infrastrukturen, beispielsweise kulturelle Infrastrukturen, das ist ganz offensichtlich. Da muss man sich überlegen, auch über solche Krisen hinweg: Wie kann man den Leuten da die Existenz sichern? Und da kommt man natürlich schnell auf das Bedingungslose Grundeinkommen. Aber da steckt ja viel mehr drin, und es ist natürlich ein total vermintes Terrain in der politischen Debatte, das dominiert wird von allen möglichen Reflexen von beiden Seiten, also Befürworter*innen und Gegner*innen. Du sagst, man wundert sich hier, dass der DGB oder sein Vorsitzender eher ablehnend sind. Aber man wundert sich über andere Sachen ja auch, etwa, wieso die als erstes auf eine Kaufprämie für Autos kommen, um die Krise zu überwinden. Aber ich glaube, was das Bedingungslose Grundeinkommen irgendwie zu so einem Kampfgegenstand werden lässt, ist die Bedingungslosigkeit, und ich finde aber, ehrlich gesagt, dass das der zentrale Punkt ist, über den ernsthaft diskutiert werden müsste. Dass nämlich wirklich Jeder und Jede das BGE bekommen soll. Da wird ja immer gesagt „Ja, warum soll der Millionär das bekommen?“ usw. Das ist eine Prinzipienfrage, ob alle Bürger*innen, egal, was sie sonst tun, wie sie gepolt sind, wo sie herkommen usw., ob alle Bürger*innen gleich sind in ihrer Existenzberechtigung und zwar dann auch in ihrem materiellen Subsistenzrecht. Und da fällt einem dann immer der Multimillionär ein: Warum soll der ein Grundeinkommen bekommen?! Aber viel relevanter ist doch, dass einem als erstes der Migrant oder die Migrantin einfallen müsste. Die Person, die gestern noch nicht hier war, heute hier ist, soll die sofort das volle Grundeinkommen bedingungslos bekommen?! Und da würde ich sagen: Ja, das ist eigentlich der prototypische Fall, die Sozialfigur, an der man die Bedingungslosigkeit festmachen kann und diskutieren müsste. Und das verweist meines Erachtens schon auf eine Achillesferse der gesamten Diskussion: Wenn wir jetzt hier in der deutschen Debatte ein Grundeinkommen fordern, wir als sozusagen die avancierten Milieus der sozialpolitischen, gesellschaftspolitischen Debatte, dann denken wir natürlich an ein Grundeinkommen für Deutschland und für Deutsche oder für Leute, die sich schon länger hier auf dem Boden der Bundesrepublik aufhalten. Dann überlegen wir „Ja bekommt man dann nach 5 oder nach 10 Jahren eines stabilen Aufenthalts hier den Anspruch, da teilzuhaben?“ – „Bedingungslos“ muss aber heißen: Alle und Jeder. Im nächsten Schritt muss man das Bedingungslose Grundeinkommen global denken. Du merkst: Das ist eine ganz andere Kiste als sozusagen eine Notspritze für Kulturberufe oder sonstige Sektoren, die jetzt von der Krise in Mitleidenschaft gezogen worden sind, sondern da sind dann ganz zentrale Fragen von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit im Spiel, und deswegen auch die starken Reflexe. Leute, die sich damit beschäftigen und dem dann auch kritisch gegenüber stehen, die wissen um die potenziell universalistische Dimensionen dieses Instruments. Aber ich glaube: Viele, die das BGE fordern, würden jetzt auch nicht sagen „Ja klar, da müsste jetzt wirklich Jeder und Jede mit ins Boot“. Deswegen finde ich, wenn man von der Bedingungslosigkeit, dass Jede und Jeder davon profitieren sollte, ausgeht, dann kommt man, glaube ich, schon ans Eingemachte dieses Vorschlags. Und dann sortieren sich womöglich auch Befürworter*innen und Gegner*innen nochmal ganz anders, neu. Da muss man dann nochmal schauen, für so eine Vorstellung von Grundeinkommen, also wirklich bedingungslosem: Wer ist da eigentlich noch dafür? Die andere zentrale Frage, die Gewerkschaften ja auch interessiert, und von der ich denke, darin steckt auch ein zutreffender Kern der Kritik: Das Grundeinkommen wird zu einer noch liberaleren, noch wilderen Gestaltung von Arbeitsverhältnissen führen. Warum sollen die Leute ein Interesse daran haben, ihre Arbeitsverhältnisse, sozusagen ihre abhängigen Beschäftigungsverhältnisse irgendwie noch beeinflussen und den Lohn nach oben treiben oder die Arbeit verkürzen zu wollen oder Ähnliches, wenn sie schon ein Auskommen haben durch das Grundeinkommen? Ich finde, der richtige Kern an dieser Stelle ist, dass wir uns – und darin liegt ein zentrales Manko der gewöhnlichen Grundeinkommens-Debatte – dass wir uns nicht nur die Verteilungsfrage oder sozusagen die Frage des Zirkulationssphäre – „Bei wem kommt das Geld an?“ – unterhalten müssen, sondern wir müssen in die Produktionssphäre schauen: Wie wird eigentlich produziert? Was wird produziert? Unter welchen Bedingungen? Wer hat da Mitsprache, wer entscheidet, wer muss sich Entscheidungen unterwerfen? Ich halte es für ein Problem, nur ein Grundeinkommen ohne die Produktionsverhältnisse zu diskutieren. Das klingt jetzt so ein bisschen orthodox und altbacken, aber ich denke, das ist wirklich ein Problem, wenn wir nur über Verteilungsverhältnisse sprechen und nicht darüber, wie der Reichtum eigentlich produziert wird, was die Folgen und Folge-Folgen sind! Dann führt so eine Debatte um das Grundeinkommen, fürchte ich, in die Irre. Das ist natürlich total schwer, all diese Tiefendimensionen mit einzubringen, wenn jetzt ein Kulturbeschäftigter sagt „He, rettet uns, wir wollen 1.000 Euro im Monat und zwar sofort und immer“.
JONAS ZIPF: Wobei alleine das ja schon nahezu revolutionär wäre. Aber erstmal finde ich es absolut überzeugend, wie du die gewerkschaftliche Kritik einbeziehst. Ich glaube tatsächlich, dass die da einen Punkt haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass das BGE auch von manchem Arbeitgeber als Instrument offensiv diskutiert wird. Es liegt nahe, dass es eine Liberalisierung von arbeitsrechtlichen Verhältnissen zur Folge haben könnte. Das ist ja das, was der DGB mit „Einschränkung von kollektivrechtlicher Gestaltung der Arbeitswelt“ oder mit „übergeordnetem Recht auf Arbeit“ meint; du hast da jetzt von der Produktionssphäre gesprochen. Tatsächlich wird eine mehrheitsfähige Diskussion von so einem Instrument nicht gelingen, wenn die Arbeitnehmer-Seite und auch die Gewerkschaften nicht mit ins Boot steigen. Andererseits wird man mit dem von Dir benannten Aspekt der Bedingungslosigkeit insbesondere in Bezug auf zugewanderte Menschen auf der konservativen Seite dieser Gesellschaft keinen Blumentopf gewinnen. Eine Mehrheit wird unter diesen Vorrausetzungen schwer zu finden sein. Daher komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Punkt der Kreativen, also zu einer möglichen Vor- und Zwischenstufe. Aus der aktuellen Situation heraus könnte man ja tatsächlich in die Richtung gehen, die auch die Gewerkschaften stärker machen, nämlich über die Sozial-Versicherungen zu reden. Wir haben im Grunde schon ein gelingendes Verteilungsinstrument, nämlich die Künstler-Sozial-Kasse. Sie ist schon so ein relativ gerechtes und relativ bedingungsloses Instrument. Wenn ich als Kreativschaffender nachweisen kann, dass ich soundso viel pro Jahr einnehme, dann komme ich da rein, das ist die einzige echte Schwelle, die es gibt, dann bin ich an der Stelle schon einigermaßen abgesichert vom Staat, relativ im Gegensatz zu anderen Versicherten, ob es jetzt in der privaten oder in der gesetzlichen Krankenkasse / Sozialversicherung ist. In Frankreich gab es das ganz lange, es nannte sich „Intermittants du spectacle“, in Italien gab es das auch. In Frankreich gibt es das auf dem Papier sogar immer noch, ist nur mittlerweile komplett ausgehöhlt. Das ähnelt Modellen wie der Bürgerversicherung und gäbe in einer etwas erweiterten Form den Kreativschaffenden die Möglichkeit, außerhalb der normalen Sozialversicherungssysteme weiterbezahlt zu werden. Wer eine bestimmte Anzahl von Arbeit, von Stunden, von Projekten in einem Jahr nachweisen kann, käme so quasi in den Genuss dieser Lohnfortzahlung für die Zeit, in der es nichts zu tun gibt, und fällt dann nicht automatisch in die sonstigen Absicherungssysteme, die einfach nicht passgenau sind. Das erleben wir ja jetzt mit Corona auch, also mit den sogenannten „Soforthilfen“ für Solo-Selbstständige, die nur funktionieren, wenn ich Betriebsausgaben gegenrechnen kann. Für Kreativschaffende, die nur von ihrem Kopf, ihrer Seele, ihren Armen leben und keine betrieblichen Ausgaben haben, keine Betriebswagen kaufen, keinen Rechner usw., für die funktioniert die Soforthilfe, funktioniert dieses Modell nicht. Da könnte eine Zwischenstufe tatsächlich sein, so ähnlich wie es die Gewerkschaft auch vorschlägt, dass man sagt, wir brauchen eine solidarischere Sozialversicherung. Eine Bürgerversicherung ist wahrscheinlich nochmal ein Kapitel für sich, aber man müsste neben den Kreativschaffenden auch die wissensbasierten Berufe, den Wissenschaftsbereich, der ja auch komplett prekarisiert ist, in solche Überlegungen einbeziehen…
STEPHAN LESSENICH: Jonas, ich muss viertel nach 10 Schluss machen.
JONAS ZIPF: Ja, ich auch – wir schaffen das, wir kriegen die Kurve.
STEPHAN LESSENICH: Was ich dazu sagen möchte: Das ist ja alles super. Nur da sieht man halt, wie schnell man sozusagen auf dem Boden der Tatsachen ankommt, gemessen an dem, was wir vorher diskutiert haben. Wer kleinteilige reformistische Schritte diskutiert, die wunderbar sind, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die nur dann wunderbar sind, wenn man sozusagen den Fluchtpunkt dessen mit einbezieht, auf den es eigentlich zugehen soll. Was wäre also das Gestaltungsziel für Arbeitsverhältnisse oder auch für selbstständige Arbeitsverhältnisse? Die Verbesserung oder die Verallgemeinerung von Künstler-Sozial-Kasse oder ähnlichen Instrumenten? Ich finde einfach, das müsste immer gerahmt werden, dass daraus ein Schritt in eine bestimmte Richtung wird, damit es nicht nur eine Notmaßnahme bleibt, sondern tatsächlich den Geist einer Erweiterung oder Standardisierung, also etwas Überschüssiges in sich trägt. Diesen Überschuss, den müsste man dann immer mitdenken. Das, was du jetzt sagst, das geht zurück in die Grundüberlegungen von sozialer Absicherung. Da ging es immer darum, den Einkommensfluss zu stabilisieren. Das ist der Anfang von moderner sozialer Sicherung. Du hast Tagelöhner oder Leute, die mal beschäftigt sind und mal nicht, mal viel verdienen, mal gar nichts. Den Einkommensfluss zu verstetigen, sozusagen im Verlauf der Zeit zu kontinuieren, das ist die Grundidee von sozialer Sicherung. Im Prinzip müsste man diese Grundidee auf alles beziehen und dann – das wäre meine Position – ein einheitliches System machen, also tatsächlich so etwas wie eine Bürger*innen-Versicherung. Und dann ist wieder die Frage: Wer ist Bürger, wer ist Bürgerin? Sind das auch die, die heute ankommen und gestern nicht da waren? Man müsste es tatsächlich für alle denken: Denn es gibt Brüche im Einkommensfluss, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist das völlig normal. Wenn wir Ökonomie so einrichten, wie wir es tun, dann ist sozusagen die öffentliche soziale Sicherung für ihre Finanzierung darauf angewiesen, sind wir solidarisch dazu gehalten, Einkommensflüsse für alle Bürger*innen zu verstetigen. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Das ist das eine. Das andere wäre, dass wir darüber nicht vergessen dürfen, warum der Einkommensfluss in der Gesellschaft immer wieder abbricht. Und zwar nicht nur bei Künstler*innen, sondern auch bei anderen, bei ganz vielen Prekarisierten in dieser Gesellschaft. Und warum es ein Strukturmerkmal von spätmodernem Kapitalismus ist. Ich würde sagen: Bedingungsloses Grundeinkommen muss immer unter gegebenen Bedingungen diskutiert werden. Da gab und gibt es in den Gewerkschaften übrigens auch schon vor längerer Zeit die Diskussion über so etwas wie eine bedingungslose Grundzeit. Also letztlich allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Neben der Verstetigung des Einkommens wäre das der andere Hebel, tatsächlich radikale Arbeitszeitverkürzungen, und möglichst weitgehend. Nicht zuletzt auch, um das, was wir aus Angst, aus Zurückhaltung anders zu denken, vorhin diskutiert haben: Wenn man das Denken in Alternativen ermöglichen möchte, dann braucht man nicht nur Geld, nicht nur soziales Auskommen und das Einkommen fürs Auskommen, sondern man braucht auch Zeit. Man braucht Zeit und Raum zum Denken und Sich-Austauschen. Und so gesehen, ist eine bedingungslose Grundzeit eigentlich mindestens so relevant wie das bedingungslose Grundeinkommen.
JONAS ZIPF: Das war jetzt auf den Punkt. Da merkt man auch, wie sehr du es gewohnt bist, über sowas zu sprechen. Und dass zum Soziologen noch der Politiker tritt. Als ob ich jetzt dein Interviewer im Radio wäre und sagte „Für diesen O-Ton haben wir 43 Sekunden Zeit, dann kommen die Nachrichten…“ – Genauso hast du es jetzt auf den Punkt gebracht. Ja, tatsächlich dankbar bin ich an der Stelle für den Hinweis darauf, dass man die Produktionsverhältnisse oder die Produktionssphäre nicht aus dem Blick verlieren sollte – das hast du ja jetzt zuletzt nochmal angeschnitten, mit der Frage der Arbeitszeit-Gestaltung, vor allem die historische Perspektive. Und das ist wahrscheinlich der mehrheitsfähigste Punkt an all diesen Diskussionen, nämlich, dass das volkswirtschaftliche Schmiermittel Einkommensfluss, ja letztlich Kaufkraft heißt. Das ist genau die Logik der Krisenbewältigung, die gerade auch makropolitisch stattfindet. Wir meinen dafür sorgen zu müssen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Das sind ja die Hauptinstrumente – Mehrwertsteuer, Kindergeld, usw. die gerade angewandt werden. Deswegen glaube ich, sind die historische Perspektivierung und Kontextualisierung an dieser Stelle ganz wichtig.
Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten – und wir merken das ja in unserem kurzen Gespräch, dass da noch viel, viel mehr dranhängt und drinsteckt –, würden wir jetzt praktisch sofort wieder einsteigen in die Diskussion, die dahinter liegt, nämlich die Frage, ob dieser Konsum wirklich das richtige Schmiermittel ist. Und du sagst, wir müssen einen Blick dafür haben, worauf es hinführt, wir müssen natürlich über den weiteren Horizont reden…
STEPHAN LESSENICH: Dafür ist eben auch bedingungslose Grundzeit wichtig, also überhaupt die Bedingungen der Möglichkeit zu schaffen, dass die Leute gemeinsam überlegen, was sie mit ihren Konsummöglichkeiten, die durch den stetigen Einkommensfluss gewährleistet sind, anfangen wollen. Das ist natürlich immer so eine bildungspolitische Vision: Ja, wir wollen weniger konsumieren und weniger initiieren. Das wird man nicht im Griff haben. Aber den Leuten doch die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam zu überlegen, was sie überhaupt wollen, das ist und bleibt nun mal das A und O.
JONAS ZIPF: A und O. Damit schaffe ich jetzt leicht einen Bogen zum Anfang des Gespräches. Da haben wir nämlich über die Sinnhaftigkeit von Smartphones und unserem Fußballkonsum gesprochen, und die Zeit, sowas zu reflektieren, müssen wir unbedingt finden…
STEPHAN LESSENICH: Ja, denn eigentlich hat das Gespräch ja gerade erst so richtig angefangen. Wenn Du jetzt hier wärst und wir es könnten, dann würden wir uns die Zeit einfach nehmen, einen Kaffee kochen und voll einsteigen.
JONAS ZIPF: Corona hin oder her. Raum und Zeit hängen eben doch zusammen. Lass uns das machen. Das nächste Mal, wenn ich in München bin.
STEPHAN LESSENICH: Oder wenn ich wieder in Jena bin.
JONAS ZIPF: So sagt man das. Und macht es dann doch nicht. Oder schaffen wir das? Alles eine Frage des Leidensdrucks, will mir scheinen…
STEPHAN LESSENICH: Doch. Lass uns das machen. Statt der Zeit für Smartphone, Fußball & Co…!
JONAS ZIPF: You name it. Die Wette gilt.
STEPHAN LESSENICH: Ich muss jetzt.
JONAS ZIPF: Ich auch. Der nächste Termin steht quasi schon in der Tür.
STEPHAN LESSENICH: Bis dann. Ciao.
JONAS ZIPF: Bis denne. Ciao.

Stephan Lessenich, 1965 in Stuttgart geboren, studierte von 1983 bis 1989 Politikwissenschaft, Soziologie sowie Geschichte an der Philipps-Universität Marburg. 1993 erfolgte seine Promotion an der Universität Bremen. Er war Habilitationsstipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und habilitierte sich 2002 an der Universität Göttingen für das Fach Soziologie. Ab 2004 war er Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Vergleichende Gesellschafts- und Kulturanalyse an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dortiger Direktor, gemeinsam mit Klaus Dörre und Hartmut Rosa, der DFG-Kollegforschergruppe „Postwachstumsgesellschaften“ am Institut für Soziologie. Zum Wintersemester 2014/2015 wurde er als ordentlicher Professor auf den Lehrstuhl für Soziale Entwicklungen und Strukturen an das Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Seine Arbeitsgebiete sind die politische Soziologie sozialer Ungleichheit, vergleichende Makrosoziologie, Wohlfahrtsstaatsforschung, Kapitalismustheorie und Alterssoziologie. Er ist u. a. Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Netzwerks Grundeinkommen und der deutschen Organisation des Basic Income Earth Network (BIEN) für ein Bedingungsloses Grundeinkommen.